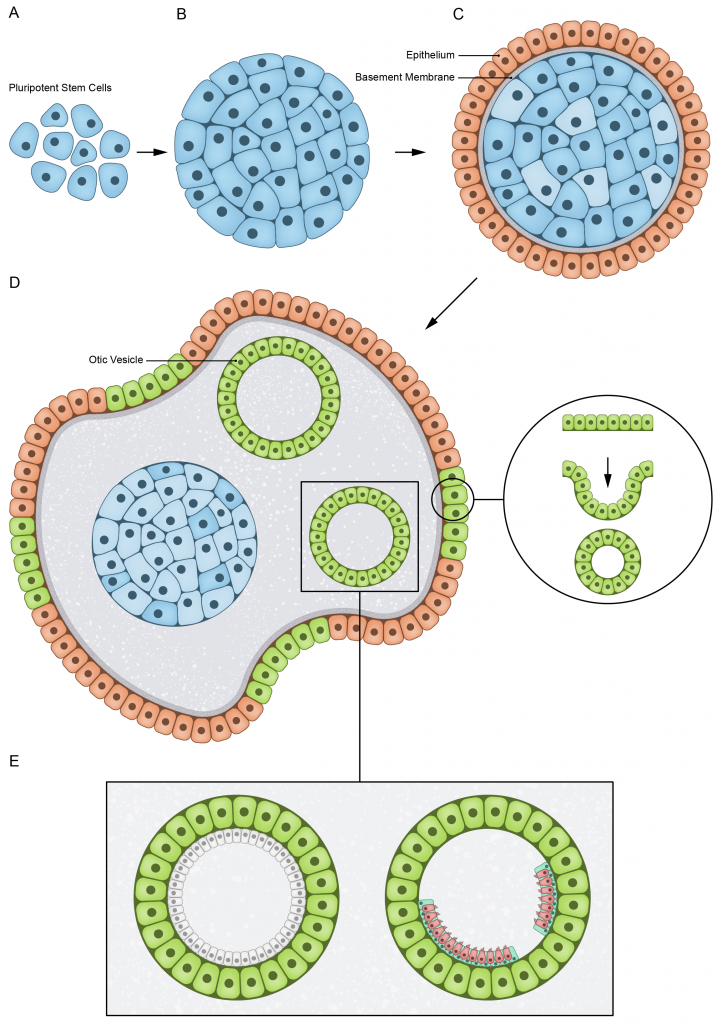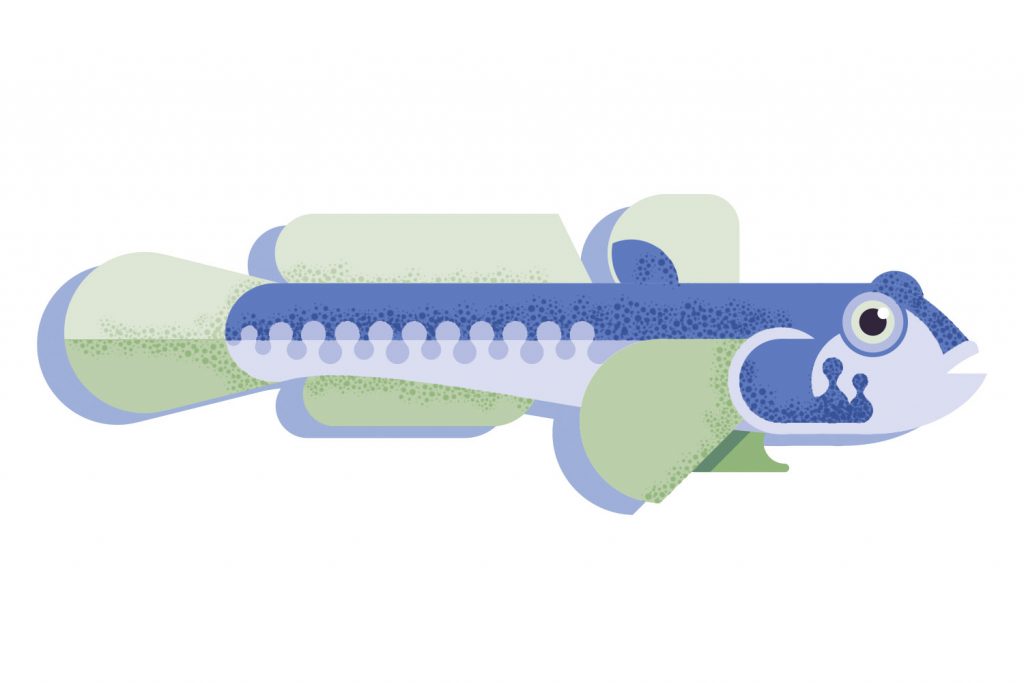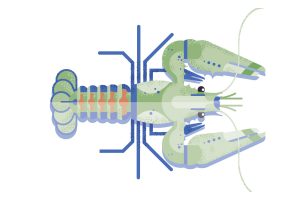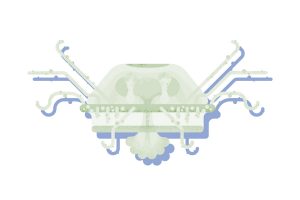Dezember 8, 2022
Interview mit Frederic Siegel (Mitglied Kollektiv Team Tumult)
Über das Zürcher Creative Kollektiv Team Tumult haben wir Frederic Siegel erreicht und freuten uns riesig, dass er sich bereiterklärt hat das Interview durchzuführen. Es fand via Teams statt, da sich Fredi zu diesem Zeitpunkt in einer Künstlerresidenz in New York aufhielt.
Dieser Ortwechsel über 4 Monate hinweg ermöglicht ihm, sich inspirieren zu lassen, die Stadt kennenzulernen, zu arbeiten und Netzwerke zu erschliessen.
Frederic Siegel ist ein schweizer Animator, Animationsregisseur, Illustrator, Lehrbeauftragter für Animation an der Fachhochschule in Graubünden und Bern. Dazu ist er Mitglied des in Zürich ansässigen Kollektivs Team Tumult. Mit seinen Animationen gewann er bereits einige Preise und Awards, die ihm in seiner Karriere viele Türen öffneten. Neben Auftragsarbeiten im Kollektiv und dem Dozieren, arbeitet er an eigenen und persönlichen Projekten.
Nach dem Gymnasium arbeitete Fredi ein Jahr, bevor er den Vorkurs in Luzern besuchte. Darauf folgte das Bachelorstudium mit dem Schwerpunkt in der 2D Animation, welches er mit dem mehrmals ausgezeichneten Film «Ruben Leaves» erfolgreich abschloss. In der Studienzeit knüpfte Fredi viele Kontakte, von denen er später profitieren konnte und diese auch bis heute noch pflegt und schätzt.
Für die Zukunft plant er einen Master zu machen, um sich zu spezialisieren und da ein Masterstudium Voraussetzung für eine Festanstellungen an Hochschulen und Unis ist.
Die Abschlussarbeit «Ruben Leaves» erntete grossen Erfolg. Dadurch gelang ihm einen organischen Übergang in die Arbeitswelt. Er wurde an diversen Filmfestivals gezeigt, wodurch einige Musikgruppen auf ihn aufmerksam wurden und Fredis Animationen für ihre Musikvideos miteinbeziehen wollten. Eine Pause nach dem Studium gab es also nicht, denn zusätzlich absolvierte er ein 6-monatiges Praktikum bei Vaudeville Studios GmbH in Zürich. Gleichzeitig arbeitete er an einem neuen Kurzfilm. In dieser Zeit entstand auch die Idee für das Kollektiv Team Tumult.
An die Aufträge ist das Kollektiv «Team Tumult» zu Beginn über das eigene Netzwerk, Freunde und Bekannte, mithilfe von Mund-zu-Mund-Propaganda und Visitenkarten gelangt. Viele Künstler wurden durch Fredis Film «Ruben Leaves» auf ihn aufmerksam. Auch durch die Teilnahme an Branchenevents wurde das Kollektiv gesehen und gehört und lernte die Zürcher Animationsszene kennen. Ein weiterer Antrieb war die erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben und ein dadurch entstandenes Film-Projekt für das Museum für Kommunikation in Bern.
Von Beginn an hatte das Kollektiv Social-Media-Kanäle gepflegt. Doch am Anfang, vor etwa 7 Jahren, war das noch nicht sehr wichtig. Nach etwa zwei Jahren hatten sie eine gewisse Reichweite, doch bis heute erhalten sie die wichtigen Aufträge via E-Mail. Es ist dadurch schwierig einzuschätzen, wie viel Einfluss Social-Media effektiv hat.
Seine Arbeitsstelle als Dozent hat er über ein ähnliches Interview wie dieses erhalten. Die Studenten veröffentlichten das Interview auf ihrem internen Schul-Blog, der von der Schulleitung gesehen wurde. Sie waren auf der Suche nach einem Dozenten für Animation und waren vom Interview überzeugt, worauf sie Fredi direkt anfragten. Das ist ein Grund dafür, weshalb er sich für solche Interviews jeweils gerne Zeit nimmt, denn schliesslich ist das auch Werbung für ihn.
«Solche Interviews mache ich immer sehr gerne, da man nie weiss was daraus entstehen kann»
Einen normalen Arbeitstag gibt es bei ihm nicht. Das Kollektiv hat ein Büro in Zürich, die Mitglieder arbeiten aber auch oft ausserhalb, da viele während der Pandemie zurück in die Heimat gezogen sind. Dazu kommt, dass fast alle zusätzlich einen Arbeitsplatz in einer anderen Stadt haben. Fredi selbst ist etwa 2 Tage in der Woche in Zürich und 2 Tage in Bern, in seinem zweiten Büro. Wenn das Kollektiv einen Auftrag erhält, wird zuerst ein Projektleiter oder Projektleiterin bestimmt, welcher die Aufgaben an die jeweiligen Personen verteilt. Solche Aufgaben sind bei einer Animation das Design und die Characters, Skript und Kundenkontakt, Storyboard, die Animation selbst, das Sounddesign, dass meist von externen Personen gemacht wird, und die Musik, welche je nach Budget von Musikern gemacht oder von einer Library benutzt wird. Der Projektleiter ist meist auch der Regisseur und verteilt das Budget an die jeweiligen Personen. Manche Arbeiten werden auch nur von einer Person bearbeitet, wenn es sich beispielsweise um eine Illustration handelt.
Um die Zusammenarbeit zu verbessern, macht das Kollektiv Team Tumult einen jährlichen «Ani-Jam», bei dem sie alle zusammen für drei Tage wegfahren und an einem eigenen Projekt arbeiten. Momentan arbeiten sie an einem Game und wir sind schon gespannt auf die Veröffentlichung auf der Website und auf Instagram.
Was Fredi am meisten Freude bereitet ist, wenn er an seinen eigenen Projekten arbeiten und seinen Ideen freien Lauf lassen kann.
Die Kommunikation mit den Kundinnen und Kunden während den Projekten macht ihm an seiner Arbeit am meisten Mühe. «Für eine extrovertierte Person mag das aber vielleicht ein sehr schöner Aspekt an der Arbeit sein», meint er.
Bei den Aufträgen ist es sehr oft so, dass die Voraussetzungen und Vorgaben unterschiedlich sind. Oft haben gut zahlende Kundinnen und Kunden konkretere Vorstellungen und kleinere Kunden lassen dem Team dabei mehr Freiheiten.
«Viel Geld und mehr stress, weniger Geld und weniger Stress.»
Nach seiner Erfahrung gilt, je mehr Geld der Auftrag einbringt desto schwieriger und fordernder sind die Auftraggebenden. Es ist wichtig eine Balance zwischen Geld und Stress zu finden.
Zum Schluss gibt uns Fredi einen wertvollen Tipp mit auf den Weg. Es ist wichtig, dass man Auftragsarbeiten nicht persönlich nehmen darf. Oftmals gibt es Veränderungswünsche, wodurch das Projekt nicht so umgesetzt wird, wie man es sich vorgestellt hat. Da muss man darüberstehen und seine Ideen bei den eigenen Projekten ausarbeiten.
Homepage:
fredericsiegel.ch und teamtumult.ch
¨