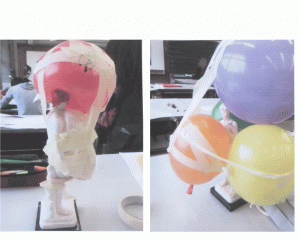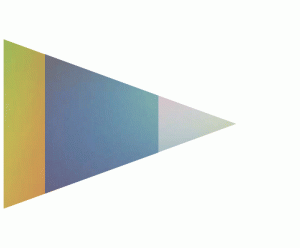Musikpädagogische Forschung: Positionen und Arbeiten aus dem deutschsprachigen Raum
Herausgeber_innen: Olivier Blanchard und Carmen Mörsch
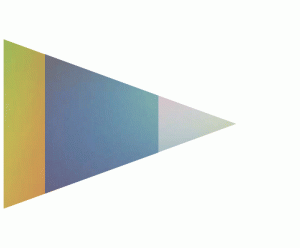
Die vorliegenden Ausgabe des e-Journal Art Education Research gibt einen Überblick über das wissenschaftliche Feld der Musikpädagogik im deutschsprachigen Raum mit Fokus auf die für das Institute for Art Education (IAE) der Zürcher Hochschule der Künste interessanten Positionen und Arbeiten.
Anders als auf der bildungspolitischen Ebene, wo im Rahmen der Entstehung des für alle deutschsprachigen Kantone einheitlichen Lehrplans 21 zurzeit rege diskutiert wird, verzeichnet die Musikpädagogik als wissenschaftliche Disziplin und als Forschungsfeld in der Schweiz bislang wenig Aktivität. Deshalb wurde am Forschungslabor für Künste an Schulen (FLAKS) des IAE zwischen Sommer 2012 und Dezember 2014 das bestehende internationale wissenschaftliche Feld der Musikpädagogik sondiert.
In diesem Kontext wurde in Kooperation mit dem Master Musikpädagogik der Zürcher Hochschule der Künste die Vortragsreihe «Musikpädagogische Forschung zu Gast an der ZHdK» ins Leben gerufen, bei welcher Forschende aus dem deutschsprachigen Raum ihre Ansätze vorstellen und diskutieren.
Ebenfalls im Zusammenhang mit dieser Stelle wurde von Olivier Blanchard und Jürg Huber in Zusammenarbeit mit Andreas Bürgisser eine explorative Studie zum schulmusikalischen Praxisfeld in der Deutschschweiz durchgeführt. Ziel dieser Studie war es, sich dem von den Lehrpersonen intendierten Musikunterricht an Deutschschweizer Sekundarschulen und Gymnasien anzunähern und damit den Diskurs um eine Position zu ergänzen, die bislang unberücksichtigt blieb. Die Arbeit wird in der vorliegenden Ausgabe im Beitrag «Zwischen Kanon und Soziokultur» vorgestellt. Dieser gibt Einblicke in persönlichen Haltungen, Zielsetzungen, Fachbegründungen, Fachstrukturen, Methoden, Rahmenbedingungen des Unterrichts und Kulturkonzepte der Lehrpersonen. Auch zeigt sich, dass einige Lehrpersonen eine hohe Sensibilität für die Diversität und die fachliche Heterogenität der Schüler_innen haben und ihren Unterricht teilweise fast ausschliesslich gemäss diesen Faktoren konzipieren.
Die weiteren Texte dieser Ausgabe zeigen eine Auswahl aus den Positionen, die im Rahmen der Vortragsreihe «Musikpädagogische Forschung zu Gast an der ZHdK» vorgestellt wurden. Sie sollen einen Einblick in die musikpädagogische Forschung im deutschsprachigen Raum geben. Bei der Auswahl war es uns wichtig Arbeiten zu berücksichtigen, die mit Fragestellungen, die am IAE in anderen Bereichen bearbeitet werden, korrespondieren. Dies betrifft Überlegungen, die Musikpädagogik an Fragen und Paradigmen der Kulturwissenschaften anzubinden (Vogt); Überlegungen, konstruktivistische Ansätze für den Musikunterricht fruchtbar zu machen, was eine Kritik am Bildungsverständnis im Sinne von Wissensanhäufung, die in sequentiell organisierten Lernschritten organisiert werden kann, impliziert (Rolle, Krause-Benz); Überlegungen zum Umgang mit der (musik-)
kulturellen Vielfalt im Unterricht, die damit verbundene Identitätskonstruktion der Schüler_innen und damit eine Kritik am normativen und holistischen Verständnis von «Kultur» (Barth) und schliesslich Überlegungen, die Diversität der Musiklehrer_innen, anstatt durch normative Setzungen in Fachdidaktiken minimieren zu wollen, für den Unterricht produktiv zu nutzen (Niessen).
Jürgen Vogt steuert in seinem Text metatheoretische Überlegungen über den Status der Musikpädagogischen Forschung bei. Er fragt, was für eine Art von Wissenschaft Musikpädagogik sei und stellt fest, dass sie sich – zumindest in Deutschland – vermehrt auf empirische Bildungsforschung konzentriert und dabei auf das Methodenrepertoire der empirischen Sozialwissenschaften zugreift. Demgegenüber stellt Jürgen Vogt Überlegungen zur Möglichkeit an, Musikpädagogik als kritische Kulturwissenschaft zu sehen. Diese Überlegungen erläutert er anhand des kulturwissenschaftlichen «Umbrella Terms» der «Performanz» und zeigt dabei auf, wie gerade die Kunsthochschule, die Performanzexpert_innen aller Art versammelt, ein prädestinierter Ort zur interdisziplinären Erforschung der Schulmusik als Performativität eigener Art sein kann.
Der Text von Christian Rolle entfaltet das Bildungspotential des ästhetischen Streits im Unterricht. Die Beschreibung der Charakteristika des ästhetischen Streits wird dafür verknüpft mit Überlegungen zu (angemessenen) Arten des Sprechens über Musik. Die Erörterung der grundsätzlichen Frage, inwiefern musikalische Erfahrungen etwas zur Bildung – verstanden als Transformationsprozess – beitragen können, bietet in den Überlegungen des Autors die Grundlage, um die Voraussetzungen fassen zu können, unter denen ästhetisches Streiten im Musikunterricht sein Bildungspotential entfaltet. Abschliessend wird danach gefragt, wie ästhetischer Streit im Unterricht initiiert werden kann.
Der Beitrag von Martina Krause-Benz befasst sich mit dem Bildungspotential eines Musikunterrichts, in dem musikbezogene Bedeutung konstruiert wird. Der Begriff «Bedeutung» wird dabei konstruktivistisch fundiert. Der «gemässigte Konstruktivismus» nach Siegfried J. Schmidt (1994) berücksichtigt bei der Bedeutungskonstruktion den sozialen Rahmen, in den das Individuum eingebunden ist. In diesem Zusammenhang muss eine Begründung einer Bedeutungszuweisung immer intersubjektiv nachvollziehbar sein. Damit wird der schulische Musikunterricht gemäss der Autorin zu einem prädestinierten Ort für die Konstruktion von Bedeutung, da Individuen mit unterschiedlichen, bereits erzeugten Bedeutungen von Musik aufeinandertreffen, welche die Bedeutungen der anderen jeweils perturbieren. So können ihr zufolge bestehende Konstrukte erweitert oder verändert und somit Bildungsprozesse angebahnt werden.
Dorothee Barth fragt in ihrem Text, welchen Beitrag die «Interkulturelle Musikpädagogik» zu dem leisten kann, was sie als Ausbildung einer «stabilen, ausbalancierten kulturellen Identität» bezeichnet. Barth bezieht sich für den Begriff der Identität auf einen (post-)modernen Ansatz, bei dem diese als relationales Konstrukt gesehen wird, welches Momente der Reflexion und der Situierung im sozialen Raum beinhaltet. Kultur versteht Barth im Sinne von geteilten Sinndeutungen gemäss eines bedeutungsorientierten Kulturbegriffes nach Reckwitz (2000). Dieses Verständnis zwingt weder Migrant_innen, sich an traditioneller Musik ihres Herkunftslandes orientieren zu müssen, noch fordert es von Kindern und Jugendlichen der Mehrheitsgesellschaft, ihre eigene musikkulturellen Wurzeln in der «abendländischen Kunstmusik» zu suchen. Schliesslich führt die Autorin aus, wie die referierten Theorien im Unterricht ihrer Meinung nach berücksichtigt werden müssten, um die Schüler_innen zu einer offenen Identitätsbildung mit mehreren musikalisch-kulturellen Zugehörigkeitsgefühlen heranzuführen und dabei zudem zu einem respektvollen Umgang mit anderen Identitäten beizutragen.
Anne Niessen hat sich als eine der ersten im deutschsprachigen Raum mit dem Nachdenken von Musiklehrpersonen über deren Unterricht bzw. deren Unterrichtsplanung befasst. Ihr Text gibt einen Einblick in eine qualitativ-empirische Studie zu Individualkonzepten von Musiklehrpersonen. Interviews zur Planung von Musikunterricht wurden mit den biographischen Hintergründen der befragten Personen in Beziehung gesetzt. Es zeigt sich, dass einerseits die Individualkonzepte nur im Kontext der jeweiligen Biographie zu verstehen sind und andererseits die Individualkonzepte für die Konstruktion der eigenen Biographie die Funktionen des Strukturierens und Fruchtbarmachens der eigenen Erfahrungen erfüllen. Angesichts der Ergebnisse ihrer Studie formuliert die Autorin die Anliegen, dass in der Ausbildung zur Musiklehrperson biographische Einflussfaktoren stärker und spätere Arbeitsbedingungen früher thematisiert werden sollen, und Probleme, auf die Lehrer_innen beim Unterrichten stossen, in Lerndiskrepanzen umgedeutet werden sollten.
Olivier Blanchard und Jürg Huber stellen in ihrem Beitrag eine explorative Studie über den Musikunterricht an Sekundarschulen und Gymnasien der Deutschschweiz vor. Es ging bei dieser Arbeit darum, einen Einblick in das Denken von Lehrpersonen bezüglich ihres Unterrichts zu erhalten und Fragen für weiterführende Forschungsprojekte zu entwickeln. Dabei wurden Lehrpersonen, mit ihren Lehrplänen als Befragungsgrundlage, online zu ihrem Musikunterricht befragt. Es zeigte sich, dass Lehrpersonen auf der Sekundarstufe I eine hohe Sensibilität für die Ansprüche, Fähigkeiten und Interessen ihrer Schüler_innen haben und den Unterricht entsprechend nach den Rahmenbedingungen ausrichten. Auf der Sekundarstufe II wird der Unterricht mehr auf die Ziele des Lehrplans ausgerichtet. Dennoch lassen sich auf dieser Stufe kontrastierende Typen von Lehrpersonen beschreiben, die verschiedene methodisch-didaktische Haltungen im Musikunterricht vertreten.
Nun hoffe ich, mit dieser Ausgabe einen Anstoss für eine Diskussion über mögliche Fragen und eine mögliche wissenschaftliche Ausrichtung der musikpädagogischen Forschung in der Schweiz geben zu können und wünsche allen Leser_innen eine anregende Lektüre.
Rückmeldungen zu dieser Ausgabe können gerne an Olivier Blanchard (blanchardoli@edufr.ch) gerichtet werden.
Wir wünschen eine anregende Lektüre!
Zu den Texten
Literatur
Reckwitz, Andreas (2000): Die Transformation der Kulturtheorien. Zur Entwicklung eines Theorieprogramms, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
Schmidt, Siegfried J. (1994): Kognitive Autonomie und soziale Orientierung. Konstruktivistische Bemerkungen zum Zusammenhang von Kognition, Kommunikation, Medien und Kultur, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Redaktion
Olivier Blanchard
Bild und Layout der Texte
Anne Gruber