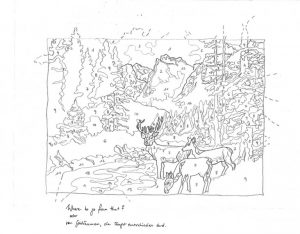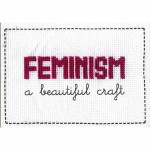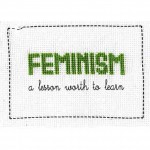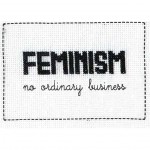Auf die Plätze.
Kunstvermittlung und das Forschen in Verhältnissen
Herausgeber_innen: Stephan Fürstenberg und Carmen Mörsch
[Illustration: Marianne Sorge]
_
EDITORIAL
In der vierten Ausgabe des eJournal Art Education Research (AER) kommen mit den Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats des Journals etablierte Akteurinnen und Akteure aus der Forschung zur Kunstvermittlung zu Wort. Dabei treffen Personen mit unterschiedlichen Praktiken und theoretischen Verortungen aus dem, sich in den letzten Jahren dynamisch und heterogen entwickelnden Feld zusammen. Idee dieser Journalausgabe ist es, die Auseinandersetzung mit Forschungspraktiken[1], verschränkt mit den jeweiligen Arbeitsbedingungen respektive Förderpolitiken in den Blick zu nehmen. Ausgangspunkt für die Entwicklung der einzelnen Beiträge war ein, mit der Einladung zum Beitrag versandter Fragenkatalog, aus welchem die Autor_innen eigene Schwerpunktsetzungen auswählen konnten und welcher zugleich aus Sicht der Herausgeber_innen die Perspektivierung des Gegenstands «Forschen im Bereich Kunstvermittlung» zu umreissen suchte:
- Unter welchen Bedingungen findet Art Education Research, finden also Forschungen im Feld von Kunstvermittlung und Kultureller Bildung an verschiedenen Standorten im deutschsprachigen Raum statt?
- Was bedeutet es, im Kontext der «Bologna-Reform» in diesem Bereich zu forschen?
- Welches sind die offensichtlichen, möglicherweise auch politisch geforderten Desiderate?
- Was sind die abseitigen, aber möglicherweise umso dringlicheren und interessanteren Fragen?
- Was bedeutet es, in diesem Bereich Forschung als Kritik zu entwickeln?
- Welche Themen und Verfahren stehen im Fokus der eigenen Arbeit?
- Was heisst es jeweils, in diesem Forschungsfeld Position zu beziehen?
Durch die einzelnen Beiträge wird Forschen im Bereich Kunstvermittlung auf verschiedene Weise betrachtet und diskutiert, wobei die Autor_innen nach eigenem Ermessen zu den spezifischen Verhältnissen, in denen Forschung stattfindet oder stattfinden soll, Stellung beziehen.
BARBARA BADER fokussiert mit ihrem Beitrag die Forschung zur Kunstvermittlung im Schweizer Raum. Sie skizziert frühe Forschungsinitiativen und stellt die Forschungsarbeit zu Kunstvermittlung an der Hochschule der Künste Bern (HBK) vor – wo ein verspäteter Start und der heteronome Status von Art Education Research Hindernisse aber auch Synergieeffekte für die Forschungstätigkeit zeitigt. Abschliessend legt Bader dar, was aus ihrer Sicht notwendig ist, um Art Education Research in der Schweiz weiter zu festigen und voranzubringen.
Mit dem Beitrag von AGNIESZKA CZEJKOWSKA wird der Konflikt zwischen eigenen forschungspolitischen Positionierungen und thematisch ausgerichteten Drittmittel-Calls im Feld der Kunst- und Kulturvermittlung, welche sich gegenwärtig oft durch eine Gleichsetzung von politischer Bildung, kultureller Bildung und Sozialpädagogik auszeichnen, diskutiert und problematisiert. Am Beispiel des Forschungsprojekts «Facing the Differences» skizziert sie, wie durch Förderprogramme formatierte Forschungsvorhaben und -aktivitäten den ihnen verbleibenden Spielraum für kritische Wissensproduktion nutzen können. Marianne Sorge ergänzt diese Auseinandersetzung mit ihren eigens dafür gestalteten Illustrationen.
«Theatervermittlung» wird von UTE PINKERT als ein sich ausdifferenzierender Arbeitsbereich und (weiter) zu fundierendes Forschungsfeld der Theaterpädagogik an Theatern entworfen, wo produktiv das Wissen der Akteur_innen sowie theoretische Erkenntnisse mit einer kritischen Auseinandersetzung mit der Institution Theater, also ihren Strukturen, Praktiken und ihrer Geschichte, verknüpft werden soll. Die Autorin stellt den diesbezüglichen Forschungsstand und mögliche Untersuchungsfelder vor, wobei sie, in Anlehnung an Carmen Mörsch, den Bezug zu aktuellen Diskursen der Kunstvermittlung herstellt und Vorschläge macht, wie diese auf das Feld der «Theatervermittlung» produktiv angewandt werden können.
WOLFGANG ZACHARIAS macht sein aktuelles Reflexions- und Handlungsinteresse im Bereich «ästhetisches und urbanes Lernen» im Zusammenhang mit «Kultureller Bildung 2.0» zum Gegenstand seiner Reflektionen. Dabei wird von ihm der Bogen von den experimentellen kulturpädagogischen Aktionen im öffentlichen Raum der Initiativen KEKS und PAEDACTION ab den 1970er-Jahren über sich daran anschliessende und ausdifferenzierende Reflektions- und Theoretisierungsarbeit bis hin zum diesjährigen Münchner Schwerpunktprojekt «kunstwerkStadt 2011» gespannt, welches die Aktualität von (städtischem und virtuellem) Raum als Lern-, Bildungs- und Forschungskontext mit unterstreicht.
Als Nachwuchswissenschaftler im Bereich der Soziologie und Nicht-Beiratsmitglied ergänzt PHILIPPE SANER diese Ausgabe mit seinem Blick auf die derzeitigen Studienbedingungen an Schweizer Hochschulen sowie Universitäten. Er diskutiert kritisch die Praktiken und Effekte rund um die sogenannte «Bologna-Reform», welche die Ausbildung – auch der Mentalitäten, Verhaltensweisen und Visionen – von Student_innen beeinflusst und die Möglichkeiten zum Forschen während des Studiums zusätzlich verknappt.
Mit EVA STURMs Aufzeichnungen wird das Seminar «How to Draw Sound. Ästhetische Übersetzungsfragen» als Raum für forschendes Zeichnen, Lehren und Lernen greifbar gemacht. Forschen wird dabei als regulierter, jedoch durch notwendige Unbestimmtheiten sich öffnender Prozess des (Ver-)Suchens, Entwickelns und Verwickeltwerdens entworfen und erprobt. Und damit die Ausbildung einer forschenden Haltung als Aspekt bzw. Anspruch von Hochschulbildung (wieder) mit ins Spiel gebracht.
Die Lehramtsausbildung für das Fach Kunst geht an der Universität für angewandte Kunst Wien mit dem Anspruch einher, reflexive, künstlerische und kritische Vermittlungsfähigkeiten zu entwickeln, wobei sich unweigerlich Praktiken und Strukturen des Lehrens, Lernens und Forschens verändern und sich miteinander verschränken (können müssen). Dazu gehören auch die – von BARBARA PUTZ-PLECKO skizzierten – drittmittelbasierten sowie selbstorganisierten Forschungsinitiativen innerhalb des universitären Kontextes, welche oftmals die Grenzen der Disziplin(en) und Institution(en) überschreiten.
Prozesse der Profilbildung und Profilierung, ein Ringen um Etablierung und Positionierung gehören für Akteur_innen im wissenschaftlichen Feld der Kunstvermittlung bzw. für die einzelnen Forschungsstandorte innerhalb der Hochschulen und Universitäten – und zwischen diesen – zum Tagesgeschäft und nehmen auf die Forschungsarbeit Einfluss[2]. Konfrontiert mit historisch gewachsenen Strukturen an den einzelnen Standorten sowie Teil von Ökonomisierungsprozessen und des bestehenden Wettbewerbs an den Hochschulen, geht es für die potentiellen Akteur_innen nicht «nur» um das Einwerben von internen wie externen Mitteln für die eigene Forschungsarbeit und damit letztlich um die Existenzsicherung der Forschungsstandorte, sondern auch um die Frage nach der Autonomie der Wissenschaft und nach Möglichkeiten eines lustvollen und sinnvollen Forschens.
Nicht erst seit der 2011 formalisierten Leistungsmessung der Forschung innerhalb der Züricher Hochschule der Künste (ZHdK) ist das Institute for Art Education (IAE) als Forschungsinstitut dazu angehalten, sich zu den gegenwärtigen Dynamiken des Wissenschaftsbetriebs zu verhalten und dazu Position zu beziehen. Dabei gilt es zum einen sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie diese Bedingungen die Forschungsarbeit am Institut beeinflussen bzw. mitgestalten. Zum anderen gilt es eine kollektive Praxis der Aneignung der Bewertungsinstrumentarien (weiter) zu entwickeln, die mit den Arbeitsprinzipien und Zielen des Instituts nicht nur vereinbar ist, sondern im besten Fall ihre Verwirklichung unterstützt und stärkt. Das betrifft die Prämissen wissenschaftlichen Arbeitens der Mitarbeitenden, ihre forschungspolitischen Perspektiven sowie ihre Visionen als Forschende – sei es zum Beispiel von der lustvollen Spannung bei der unbedingten Suche nach Wahrheiten (vgl. Pazzini 2010) oder von einer engagierten Wissenschaft, die mit ihrem «erfinderischen Geist» neue Ziele, Inhalte und Aktionen vorbereitet (vgl. Bourdieu 2008) – und dies möglichst noch mit künstlerischen Verfahren und einer wissenschaftskritischen Perspektive. Dazu braucht es neben ökonomischen Ressourcen vor allem Mut, Erfindungsreichtum und einen kritisch-solidarischen Austausch.
Um diesen Austausch zu befördern, wurde das eJournal ins Leben gerufen. Bereits die Einrichtung eines wissenschaftlichen Beirats, welcher die Herausgabe begleitet, war 2010 eine Reaktion auf gegenwärtige Dynamiken innerhalb des Hochschul- und Forschungsbetriebs. Statt dem Konzept zu folgen, Qualität und Entwicklung im Bereich Forschung durch «künstliche Inszenierung von Wettbewerb» (vgl. Binswanger 2011) und Verschärfung der Konkurrenzsituation zwischen Forschenden – nicht zuletzt durch den Rückgriff auf indikatorengesteuerte Evaluationen und Mittelvergabe – zu entfalten, sollte mit dem Beirat eine auf gemeinschaftliches Denken ausgerichtete Praxis etabliert werden. Diese Form der Zusammenarbeit wird damit auch dem im Moment stark verbreiteten, aber auch zunehmend in Kritik geratenen Verfahren anonymer Peer-Reviewings[3] als Instrument der Qualitätssicherung und Weiterentwicklung vorgezogen.
Damit «Auf die Plätze» nicht nur als ein Aufruf zum Wettbewerb im Sinne von «grösser, schneller, weiter» und als Imperativ der Drittmittel-Akquise mit ihrer disziplinierenden, oft Monotonie und intellektuellen Leerlauf produzierenden Antragsschreiberei gelesen wird, haben wir diese Ausgabe des Journals als ein Versuch des Sichtbarmachens und Öffentlichmachens von Forschungsarbeit und ihren Bedingungen, von unterschiedlichen Forschungsperspektiven und -praktiken konzipiert, um so einen Raum für Diskussionen und evtl. weitere – auch widerständige – Handlungen im Feld von Art Education Research zu öffnen.
Wir wünschen uns, dass sich «Auf die Plätze» im Rahmen der Forschungscommunity rund um Kunstvermittlung als ein Zuruf und eine gegenseitige Bestärkung (statt wettbewerbsgeschuldete Disziplinierung) etablieren könnte, um gemeinsam um den Gegenstand «Kunstvermittlung» (auf diskursiver Ebene) zu streiten und Position zu beziehen. Und um sich gemeinsam für andere Bedingungen zu deren Beforschung einzusetzen, was evtl. – wie es der weltweite Protest von Schüler_innen, Student_innen und Bildungsarbeiter_innen in seinen unterschiedlichen Formen zeigt – zu einem «Auf die Plätze … Los!» werden kann.
Zum Schluss möchten wir allen, die zum Entstehen dieser vierten AER-Ausgabe beigetragen haben, ganz herzlich danken und wünschen unseren Leser_innen eine anregende Lektüre.
[zu den Journal-Beiträgen]
_
LITERATUR
Binswanger, Mathias (2011): «Sinnlose Wettbewerbe in Forschung und Lehre». In: Bulletin fh-ch, 2/2011, S.10-11.
Bourdieu, Pierre (2008): «Für eine engagierte Wissenschaft. Über die notwendige Verknüpfung von kritischer Politik und wissenschaftlicher Arbeit». In: ak – Zeitung für linke Debatte und Praxis, Nr. 524, 18. Januar 2008, S. 16.
Meyer, Torsten/Andrea Sabisch (2009): Kunst Pädagogik Forschung. Aktuelle Zugänge und Perspektiven, Bielefeld: transcript.
Mörsch, Carmen (2012): «In Verhältnissen über Verhältnisse forschen: Kunstvermittlung in Transformation als Gesamtprojekt». In: Dies./Bernadett Settele (Hg.): Kunstvermittlung in Transformation: Perspektiven und Ergebnisse eines Forschungsprojektes von vier Schweizer Hochschulen, Zürich: Scheidegger & Spiess, S. 299f. (in Drucklegung).
Pazzini, Karl-Josef (2010): «Universitäten weitertreiben. Thesen und Notizen». In: Unbedingte Universitäten (Hg.): Was ist Universität? Texte und Positionen zu einer Idee, Zürich: diaphanes, S. 145f.
[1] Wie sie bspw. in der Publikation «Kunst Pädagogik Forschung» (Meyer/Sabisch 2009) mit dem Fokus auf Methoden, Inhalte, Gegenstände und Fragen der Kunstpädagogik aufgegriffen werden.
[2] Ein signifikantes Beispiel ist das abgeschlossene DORE-Forschungsprojekt «Kunstvermittlung in Transformation» (KiT), in dem sich Prozesse der Profilbildung der einzelnen beteiligten Forschungsstandorte in der Schweiz auf die Ausrichtung und Ausgestaltung der gemeinsamen Forschungsarbeit innerhalb des Projekts auswirkte (vgl. Mörsch 2012).
[3] Beim Peer-Review-Verfahren werden wissenschaftliche Arbeiten mittels der Begutachtung durch unabhängige Expert_innen aus dem gleichen Fachgebiet beurteilt. Wissenschaftliche Zeitschriften bspw. benutzen diese Verfahren, um über die Veröffentlichung von eingereichten Manuskripten zu entscheiden. Bei derzeitigen Leistungsfeststellungen sowie bei der Vergabe von Forschungsgeldern seitens der Förderinstanzen wird peer reviewing auch eine gewichtige Rolle zugesprochen.