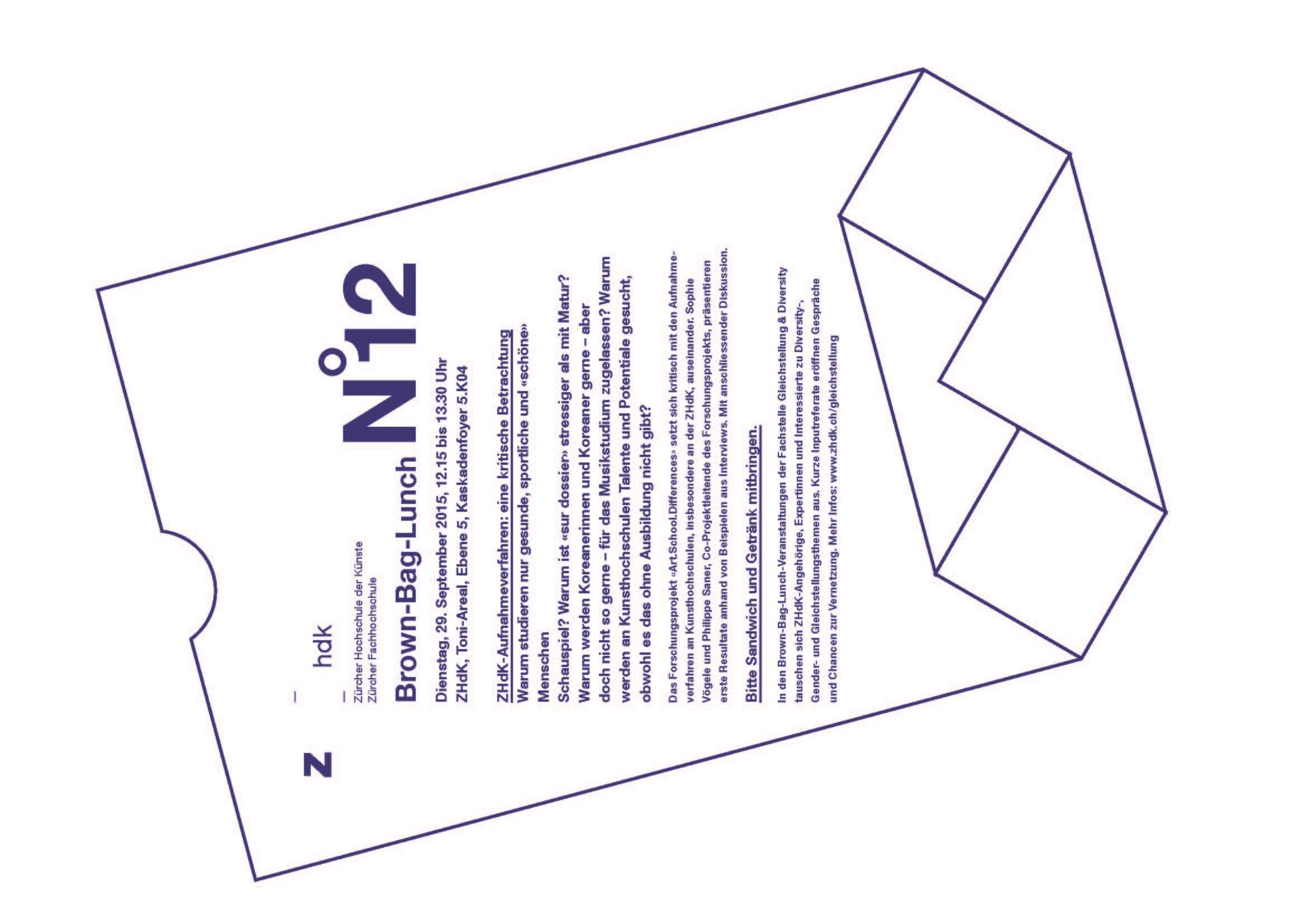Im Zentrum des 2. Kolloquiums von Art.School.Differences standen soziologische Forschungskonzepte. Die beiden öffentlichen Vorträge wurden von Ulf Wuggenig (Leuphana Universität Lüneburg) und Olivier Moeschler (Université de Lausanne) gehalten. Jackie McManus musste ihren Vortrag zu «Hopes and Fears for Art: policy and practice in widening participation in art and design higher education in the UK» leider sehr kurzfristig absagen. Umso erfreulicher war es, dass sich Ulf Wuggenig kurzerhand bereit erklärte, neben seinem Schulungs-Workshop am Samstagvormittag auch einen öffentlichen Abendvortrag am Freitag zu halten. Wir werden sobald als möglich einen neuen Termin für den Vortrag von Jackie McManus festlegen.
In seinem Vortrag unter dem Titel «Sociological Frames of References for Decision-Making in Art Schools. Value systems and their social embeddings from the perspectives of field theory, pragmatist sociology and the art worlds approach» verglich Ulf Wuggenig mehrere Theorieansätze, die in der zeitgenössischen Kunstsoziologie von übergeordneter Relevanz sind: Zum einen die Feldtheorie Pierre Bourdieus und die Systemtheorie Luhmanns, andererseits aber auch die pragmatische Soziologie der Rechtfertigungsordnungen von Luc Boltanski und Eve Chiapello, welche auf die Forschung von Boltanski und Laurent Thévenot aufbaut, sowie den Art worlds-Ansatz von Howard Becker. Die Folien zum Vortrag von Ulf Wuggenig finden sie hier.
Olivier Moeschler präsentierte in seinem Vortrag «What’s the Difference? Cultural Democratization and the Social Determinants of Artistic Practices: Theoretical Considerations and a Swiss Case Study» einige Resultate seiner Studie zu Absolvent_innen der Westschweizer Theaterhochschule (gemeinsam verfasst mit Valérie Rolle). Am Begriff des «créacteur» (zusammengesetzt aus den französischen Begriffen créateur – Schöpfer und acteur – Schauspieler) exemplifizierte Moeschler sowohl die künstlerischen, als auch unternehmerischen Anforderungen, die heutzutage an Kunsthochschulstudierende gestellt werden. Dabei zeigte sich auch, wie Projekte mit dem Ziel der Förderung von «Diversität» ungewollt bestehende Ungleichheitsstrukturen im Zugang zu einer Hochschule verfestigen können. Diese Feststellung trifft sich auch elementar mit den zentralen Forschungsinteressen von Art.School.Differences. (Siehe auch die Rezension der Studie von Marie Buscatto.)
Im Rahmen des Schulungs-Workshops vom Samstagvormittag verdeutlichte Ulf Wuggenig ausführlich die Relevanz und Bedeutung von Bourdieus Theorie der Praxis (Feld, Kapital und Habitus) für die Forschung von Art.School.Differences. Anhand der dualen Struktur im Feld der kulturellen Produktion – einem autonomen Subfeld der eingeschränkten Produktion einerseits sowie einem heteronomen Subfeld der Massenproduktion – sowie der Verortung der kulturellen Praktiken im sozialen Raum (z.B. des Museumsbesuchs) konnten einige grundlegende Funktionsweisen und Ausschlussmechanismen des Feldes der zeitgenössischen bildenden Kunst diskutiert werden.
Der Samstagnachmittag war der Weiterentwicklung und Diskussion der Forschungsentwürfe der Ko-Forschungsgruppen mit dem Team von Art.School.Differences sowie dem internationalen Beirat gewidmet. Die Ko-Forschenden brachten durch ihre Projekte verschiedene Sichtweisen ein, wie «Diversität» in den unterschiedlichen Bereichen und Ebenen der Kunsthochschule praxisorientiert be- und hinterfragt werden kann. Die Präsentationen und anschliessenden Gesprächsrunden boten Anlass zu lebhaften Diskussionen über die Forschung zu Ungleichheiten und Normativitäten an Kunsthochschulen.
Für das Forschungsteam von Art.School.Differences bot das Kolloquium auch die Gelegenheit zu einem wertvollen fachlichen Austausch mit den Vertreter_innen des International Advisory Board von Art.School.Differences. So brachte etwa Melissa Steyn (Wits School of Arts, University of the Witwatersrand, Johannesburg) die Frage nach der «Demokratisierung» von Bildungsinstitutionen aus der südafrikanischen Perspektive ein, die stark von einer «Afrikanisierung», d.h. einem Privilegienabbau der weissen Minderheit geprägt ist. Trotzdem kontrolliere diese aber nach wie vor die meisten ökonomischen Ressourcen wie auch einflussreiche Positionen in Wissenschaft und Kultur. Ruth Sonderegger (Akademie der bildenden Künste Wien) stellte in ihrem Statement die Frage, inwiefern Verständnisse von Kunst und Ästhetik in die Aufnahmeverfahren von Kunsthochschulen eingebracht werden könnten, die keinen stark eurozentristischen Bias aufweisen. Als konkreten Vorschlag stellte sie die Involvierung von Künstler_innen und Theoretiker_innen mit anderen kulturellen Hintergründen in die Aufnahmekommissionen von europäischen Kunsthochschulen in den Raum. Marie Buscatto (Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne) schliesslich machte auf die vergeschlechtlichten Arbeitsbedingungen von Studierenden an Kunsthochschulen aufmerksam, die nicht nur die Aufnahmeverfahren, sondern auch die Unterrichtsformate, die Organisation der Curricula sowie informelle Beziehungen zwischen Studierenden und verschiedenen Akteur_innen innerhalb und ausserhalb der Hochschule betreffen. Darüber hinaus verwies sie auf die Bedeutung der familiären, schulischen und ausserschulischen Vorbildungsangebote, ohne die die Aufnahme eines Kunst- oder Musikstudiums kaum zu bewältigen sei, durch welche aber auch idealisierte und vergeschlechtliche Rollenbilder «der Künstler_in» reproduziert würden.
Dora Borer und Philippe Saner, Dezember 2014