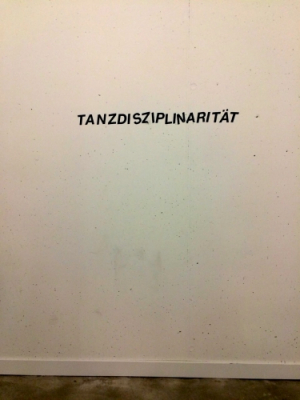Die ZHdK-Studierenden Diana, Daniel, Benjamin, Laura und Tobias beschäftigen sich in dem disziplinübergreifenden Seminar «Metaphern der Stadt. Urban Studies als Kunst und Wissenschaft» mit dem Thema Nachbarschaft. Bis auf Tobias, der sowohl Kulturpublizistik studiert als auch bei der Hochschulkommunikation angestellt ist, studieren alle im Masterstudiengang Transdisziplinarität. Die «Transen», wie sie häufig salopp genannt werden, teilen sich die Flure und eine Küche mit den Tänzerinnen und Tänzern im 7. Geschoss. Dort prallen zwei Welten aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Anlass genug, um einmal gemeinsam über das Thema Nachbarschaft nachzudenken.
Daniel: In «Metaphern der Stadt» setzen wir uns mit Kontrasten in der Stadt, im urbanen Umfeld auseinander. Wir wollen gewisse Prozesse sichtbar machen, die vielleicht verallgemeinerbar sind … Ob sich das Ergebnis auch auf das Toni-Areal oder uns anwenden lässt, steht offen.
Tobias: Nachbarschaft ist ja auch das Feld der Differenz, des Konflikts, der Kommunikation, der Auseinandersetzung. Das ist interessant. Am Toni kommen plötzlich verschiedene Abteilungen zusammen und sollen mit einem Mal unter einem Dach agieren. Hierbei gibt es die Erwartung, dass der Groove der Zusammenarbeit unmittelbar beginnt. Aber vielleicht müssen die neuen Nachbarn hier im Haus auch erst einmal Phasen des Konflikts durchschreiten, Differenzen verhandeln, Dissens ertragen, austragen und zum Ausdruck bringen. Ich arbeite parallel zum Studium in der Hochschulkommunikation, ein Bereich, der diese Aufgabe aus meiner Sicht nicht übernehmen kann, denn dort findet eher die Repräsentation nach aussen statt. Da ist der Toniblog das geeignetere Medium, um diesen Prozess zu beobachten und zu dokumentieren.
Redaktion: Könnt Ihr als Studierende denn am eigenen Leib erfahren, wie und ob dieser Dissens verhandelt und verbalisiert wird? Wo manifestiert er sich?
Daniel: Ich sehe mich allzu oft mit Bürokratie konfrontiert. Der Hochschul-Apparat stellt sehr viel Aufwand her, wenn man etwas Bestimmtes erreichen oder haben möchte. Das ist zwar nachvollziehbar, aber aus meiner unwissenden Perspektive auch manchmal mühsam.
Tobias: Wenn alle aneinander vorbeigehen, merkt man gar nicht, dass Konsens oder Dissens da ist. Das ist kein ZHdK-spezifisches Problem, sondern das ist überall so. Gleichzeitig ist die ZHdK das Feld, wo Gestaltung und Kunst entstehen kann, wo Ungleichheit herrscht, sichtbar und fruchtbar wird. Es wäre schön, wenn mehr über dies und das gestritten würde. Gerade nach dem Amok-Alarm wurden die Differenzen zwischen Sicherheit und Angst – und der unterschiedliche Umgang damit sehr schön sichtbar. Kurzum: Es müsste ein Förderungsprogramm der Differenz-Wahrnehmung geben!
Diana: Ich finde es schade, wenn man immer erst alles institutionalisieren, initiieren oder animieren muss, damit etwas passiert. Es ist doch eh schon so viel vorgegeben. Entweder hat man eine Gemeinsamkeit, durch die man zusammenkommt, oder eben einen Konflikt, über den man aneinandergerät … Unsere Nachbarn sind ja 14- oder 15-Jährige, die da neben uns den klassischen Tanz erlernen. Ich habe bisher weder einen Konflikt noch eine Gemeinsamkeit wahrnehmen können.
Redaktion: Dort kann sich also gar keine fruchtbare Nachbarschaft entfalten?
Diana: Für mich nicht. Aber ich bin auch nur circa einmal wöchentlich vor Ort.
Benjamin: Ich sehe das ein bisschen anders. Die Flure und die Wände des Flurs sind ein Beispiel. Während wir die Flure benutzen, um uns dort aufzuhalten, gebrauchen die Tänzer die Flure, um sich warmzumachen – und gerade dieser Raum ist aushandelbar. Da ist noch Potenzial für die Ausgestaltung. Der Flur, die Wand – das ist so ein Zwischenraum. Metaphorisch gesprochen: Bei klassischen Nachbarschaften entspricht unser Flur vielleicht dem Gartenzaun, an dem die Nachbarn und Nachbarinnen sich begegnen können oder über ihn hinweg die Nachbarn im Garten stehen sehen. Dies ermöglicht überhaupt erst, dass Kommunikation entstehen kann, zugleich aber nicht entstehen muss. Dazu braucht es aber den Moment des Einzugs, zu welchem die Nachbarn einander vorstellen – und den haben wir verpasst. Das ist hier aber auch schwierig gewesen, weil wir alle gleichzeitig eingezogen sind. Das ist in Neubauten vielleicht dasselbe Problem? Das Fest wäre eine Anlass gewesen, sich vorzustellen, aber da ist bei uns Transen nicht viel passiert.
Daniel: Ich habe auch den Eindruck, dass das ganze Departement Tanz einen ganz eigenen Rhythmus und ein sehr dichtes Programm an Kursen hat. Die Tänzerinnen hetzen immer nur flüchtig über die Gänge und haben keinen Blick für das, was rechts uns links passiert. In dem, was sie tun, ist dieser Kontext auch gar nicht gefragt! Im Gegensatz zu uns nutzen sie ihre Räume, um sich Fertigkeiten anzueignen und nicht, um die Räume zu hinterfragen. Während bei uns das Interesse eher ist: Wo sind wir hier? Was machen wir hier? Was sollen wir hier machen? Was dürfen wir hier nicht machen? Das Interesse an den Zwischenräumen und der Nachbarschaft ist ungleichmässig verteilt. Ein paar einzelne Tänzer kenne ich übrigens bereits. Aber die siezen mich immer, sind ganz verhalten. Aber immerhin sagen sie sich offenbar: «Den kenn ich.» Während die Anderen apart über die Gänge schweben und ihr Aussen nicht wahrnehmen. Aber das ist auch nur mein Eindruck.
Laura: Meistens kann man seine Nachbarn ja nicht wählen und ist in diesem Zusammenhang manchmal auch mit seinen eigenen Vorurteilen konfrontiert. Das ist ein spannendes Moment. Somit würde ich vorerst die Eindrücke von Daniel teilen. Jedoch kann es natürlich auch ganz anders sein: Vielleicht machen sich die Tänzer ja auch Gedanken über die Nutzung der Wände, der Flure oder über uns. Die größte Differenz, die mir auffällt ist, dass ich im Studiengang Transdisziplinarität versuche etwas über die Disziplinen hinaus zu fassen oder zu begreifen. Und ich denke, dass das im Bereich des klassischen Tanzes anders ist. Ich denke es ist wichtig, sich dieser Differenzen anzunehmen und darüber hinaus eine Offenheit gegenüber anderen zu besitzen, um persönliche Eindrücke hinterfragen und erweitern zu können.
Tobias: Wäre es für Euch als Transen nicht eine Herausforderung, eine Brücke zu bauen oder ihnen das Bein zu stellen, irgendetwas zu initiieren?
Daniel: Wir haben ja viel Platz. Wir könnten sie ruhig einmal zu uns einladen, während wir unser Seminar im Tanzsaal abhalten.
Redaktion: Wie manifestiert sich die von Euch beschriebene Nachbarschaft zu den Tänzern in der gemeinsamen Teeküche?
Daniel: Wir haben einmal aufgeschnappt, dass seitens der Tänzer ein Unbehagen herrscht, dass wir diese Teeküche verwenden. Ein Lehrer hat uns das gesagt – aber es klang eher so, als sei diese Nachricht so durchgesickert und nicht offiziell. Ich nutze durchaus hin und wieder die Mikrowelle oder esse dort etwas. Aber wenn ich da bin, sind selten andere da. Da findet keine Interaktion statt.
Benjamin: Unser Flur im 7. Geschoss ist bestimmt der tragischste Ort der ganzen Hochschule. Ich habe schon zwei weinende Tänzerinnen gesehen. Da frage ich mich natürlich, was vorgefallen sein mag. Klar ist, dass etwas passiert ist, was nicht klar ist. Die Räume der Tänzer da oben schreien nach Disziplin. Ich hatte im Hinblick auf die Nachbarschaft zu den Tänzern keine spezifischen Erwartungen im Vorfeld: deshalb konnte ich weder überrascht noch enttäuscht werden.
Redaktion: Im Flur prangt dieser Aufdruck «Tanzdisziplinarität» an der Wand. Das sagt ja doch ganz laut aus: Hier besteht eine Nachbarschaft.
Daniel: Ja, nach dem Fest waren diese Buchstaben plötzlich da. Ich weiss nicht, wer das initiiert hat. Wir haben jetzt aber eher nur über negative Aspekte der Nachbarschaft gesprochen – und es gibt ja auch positive. Ich habe hier täglich spontane Begegnungen mit Menschen, flüchtige Gespräche, kann aber auch mit bestehenden Freuden aus anderen Departementen zusammenkommen, kurz gemeinsam Kaffee trinken … Da entsteht auch viel Positives.
Redaktion: Inwiefern entsteht dabei wirklich etwas – also über den sozialen Austausch hinaus?
Daniel: Die Herstellung von Sozialität ist ja schon eine Form von Produktion. In ihr ist etwas angelegt, was darüber hinausweisen kann. Ich kann neuerdings verschiedene Orte im Toni aufsuchen und fragen, ob jemand Bestimmtes jetzt Zeit hat oder mir helfen kann … Die Schwelle ist viel geringer, so etwas auch zu fordern. Ich nehme plötzlich all die Schnittstellen wahr – und das Potenzial, das Miteinander voll auszuschöpfen.
Tobias: Ich glaube es ist gut, wenn die Schnittstellen, die angeeignet werden dürfen, charakterisiert und definiert werden könnten, z.B. die Aussenwände der Büros. Wenn diese Erwartungen institutionalisiert werden, kann vieles entstehen. Bei Nachbarschaften in Mietshäusern lässt sich das schön beobachten: Bei manchen stehen Schuhe vor der Tür, bei anderen ist es verboten. Dort, wo es verboten ist, wird auch zwischenmenschlich mehr Neutralität und Distanz gewahrt. Wenn man über die Aneignung des Gebäudes spricht, finde ich den Aspekt des gestalterischen Erschliessungsraums wichtig. Als wir hier im Mai 2014 eingezogen sind, waren sofort drei Leute vom Hausdienst zur Stelle und haben uns gebeten, keine Bilder aufzuhängen. Es war eher eine technische Info: «Bitte keine Schrauben, keine Nägel.» Die Bitte bestand darin, die Aufhängungen gemeinsam mit dem Hausdienst zu machen. Doch der Grundimpuls geht seither nicht mehr weg: «Lasst bitte die Wände in die Ruhe.» Und aus meiner Perspektive als Student habe ich erst recht keinen Ort, den ich aneignen könnte.
Diana: Ich bin so wenig da … Es gibt Begegnungsorte. Das genügt mir.
Laura: Ich denke, dass innerhalb des Toni-Areals eine aktive Nachbarschaftspflege gefragt ist. Diese würde den Zugang zu den anderen Disziplinen ermöglichen und verlangt viel Eigeninitiative. Vielleicht habe auch ich diesen Moment verpasst. Wir wurden in dieses Haus verpflanzt und mit der Zeit wurde deutlich, dass wir etwas dazugeben können und sollen; das Potenzial dieser Umgebung ist ja, dass ich die Grenzen austesten, überschreiten und schauen darf, wie weit ich komme.
Nachbarchaftlich arbeiten auch die Departemente Fine Arts, Kammermusik und Transdisziplinarität in dem Projekt «In Nachbarschaft» zusammen: die Beiträge werden am 17.04.2015 im Toni-Areal gezeigt und aufgeführt.