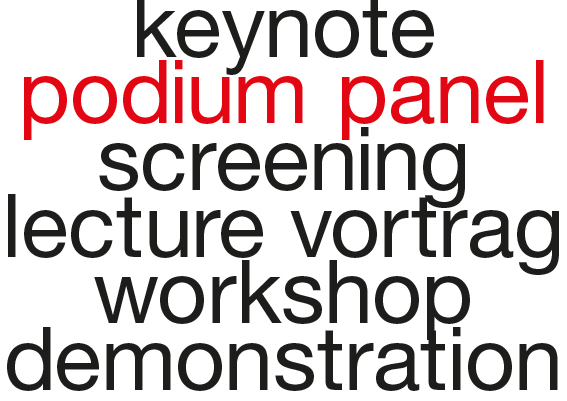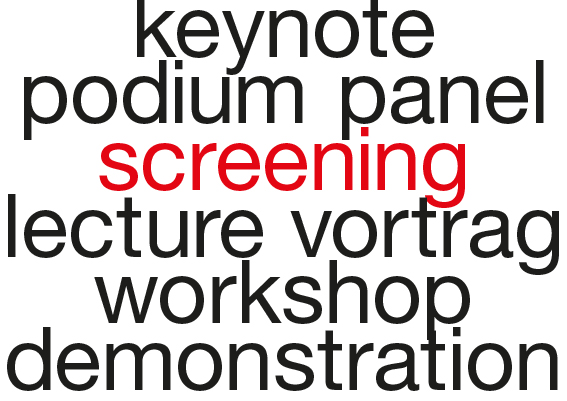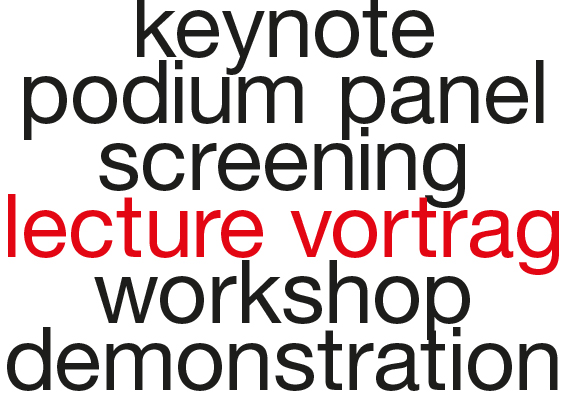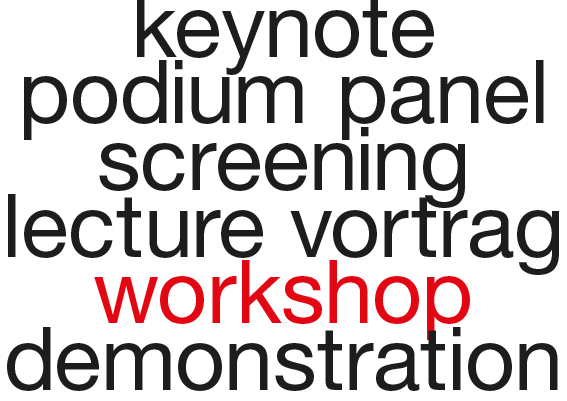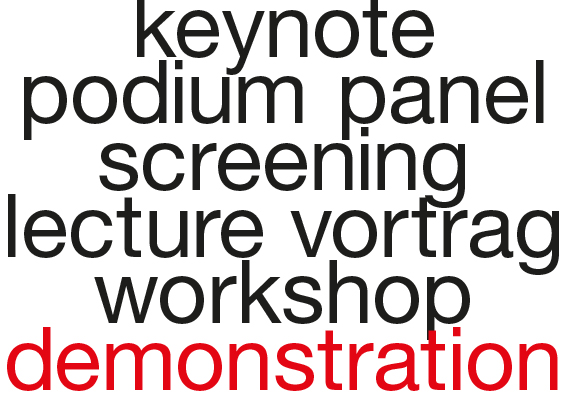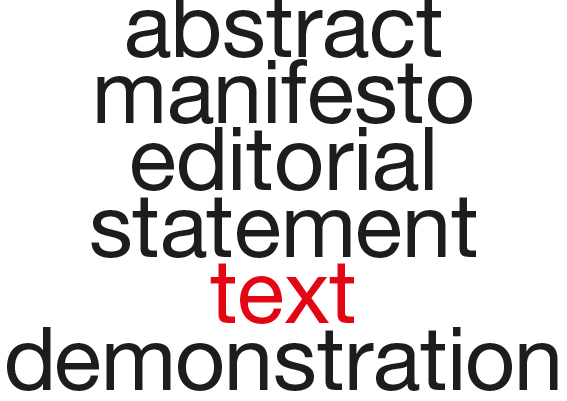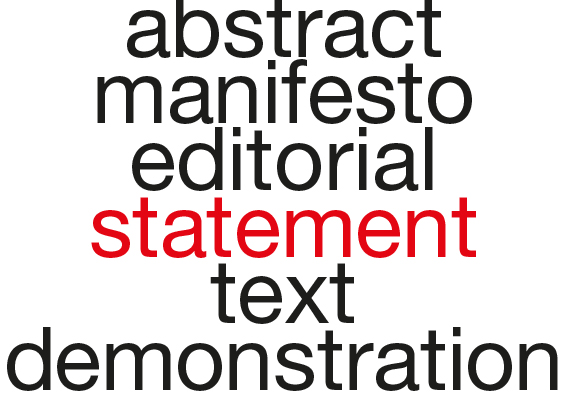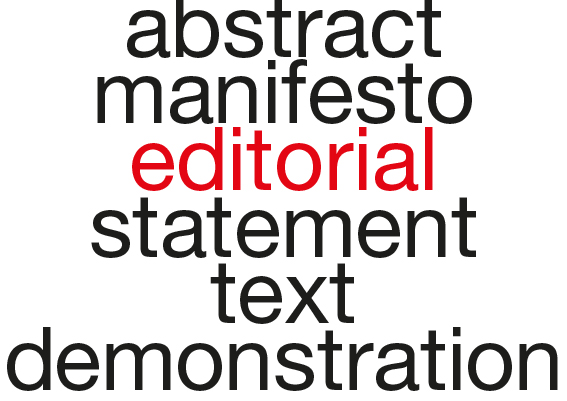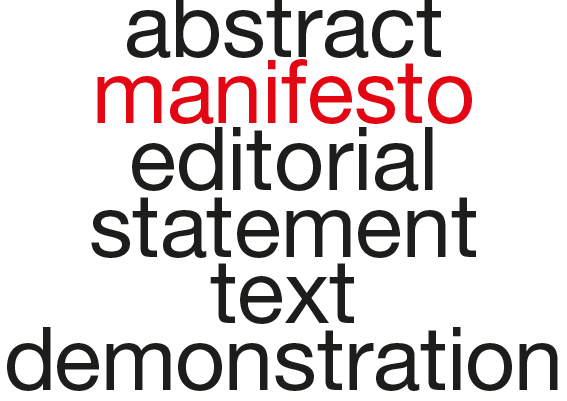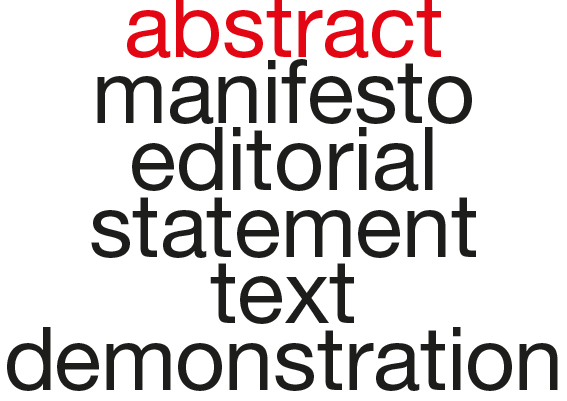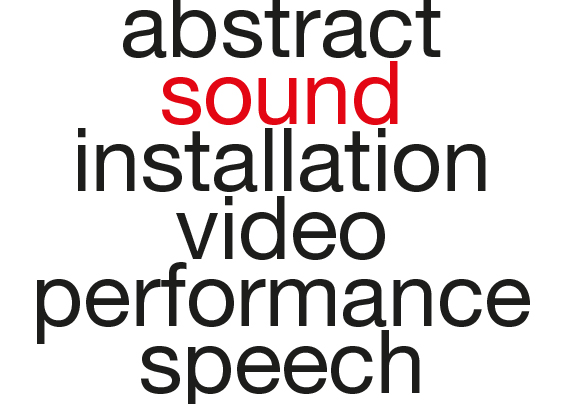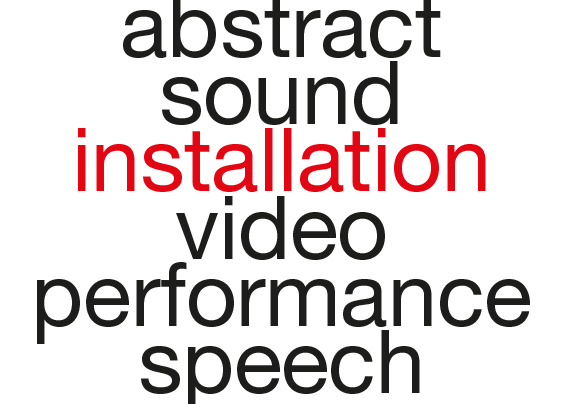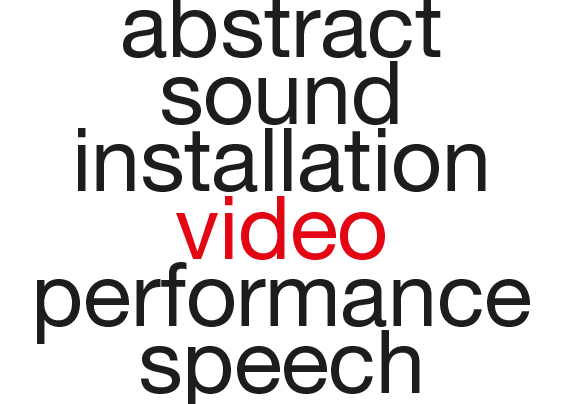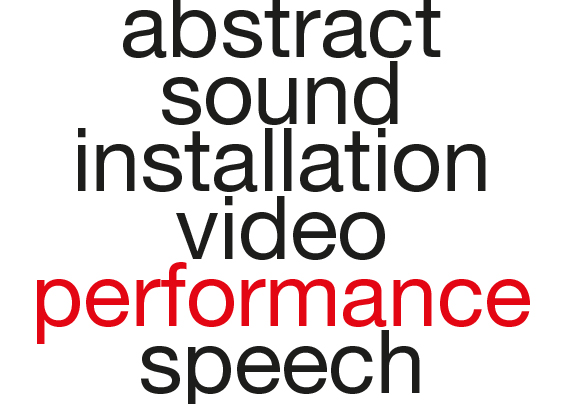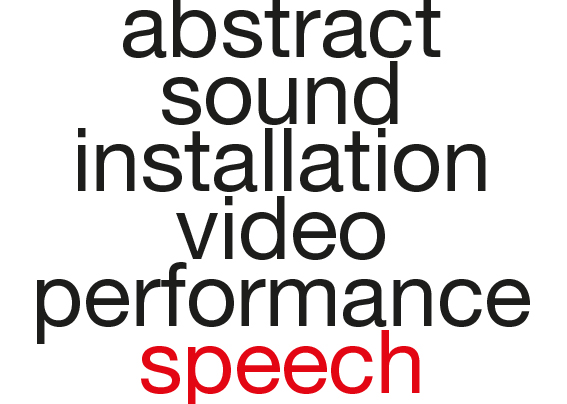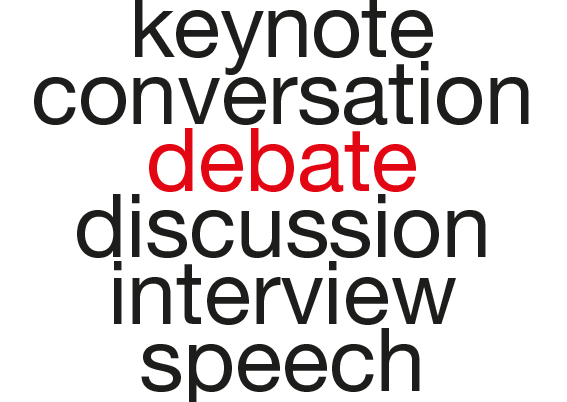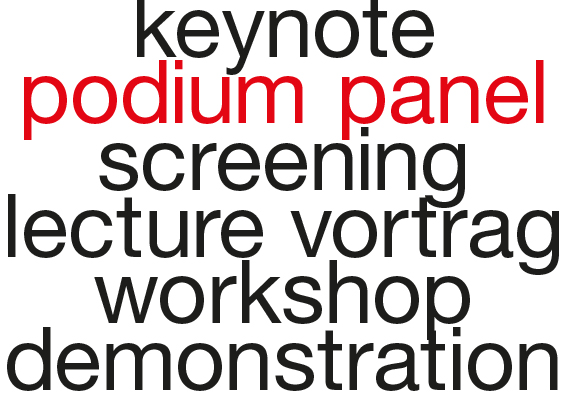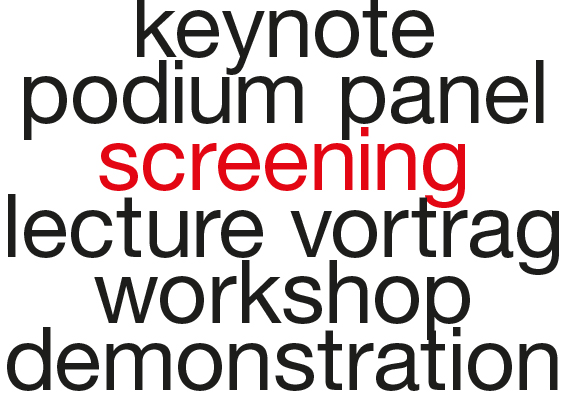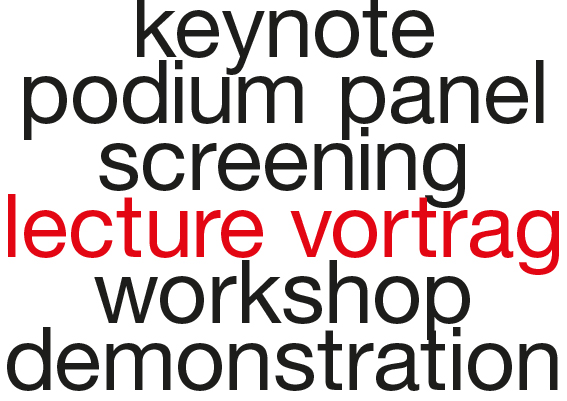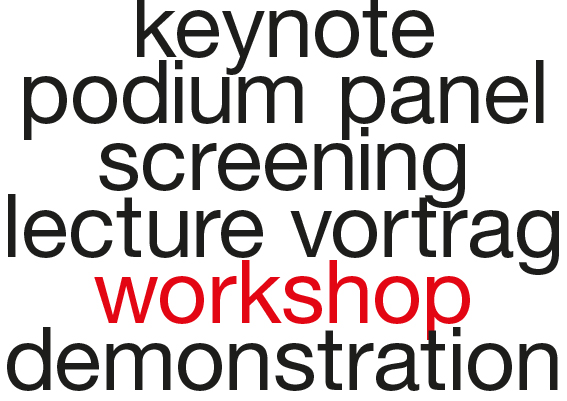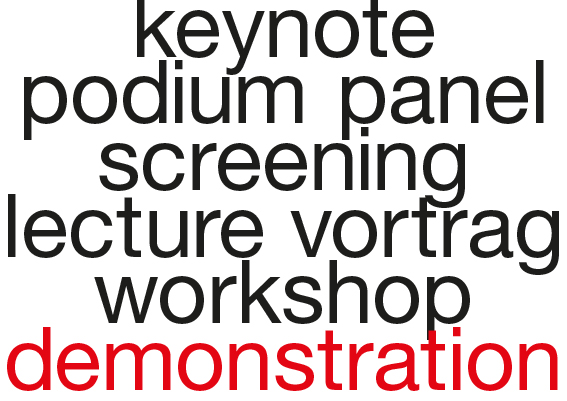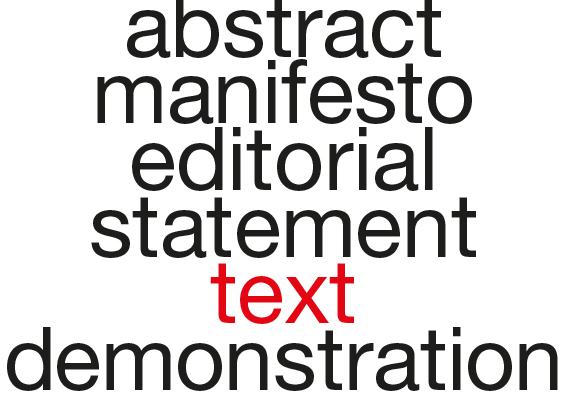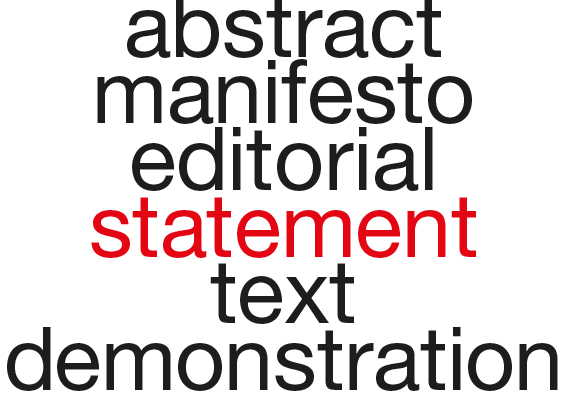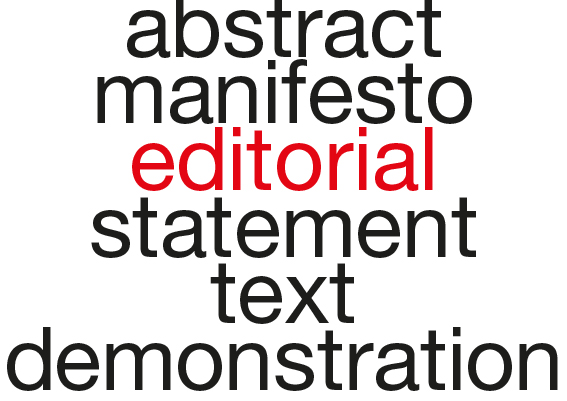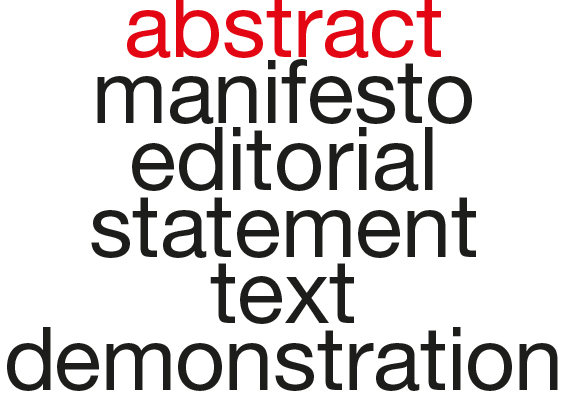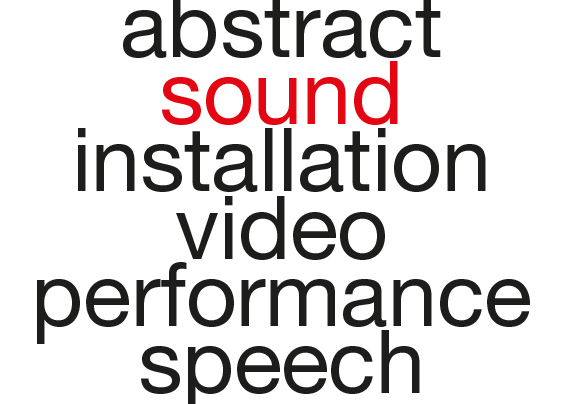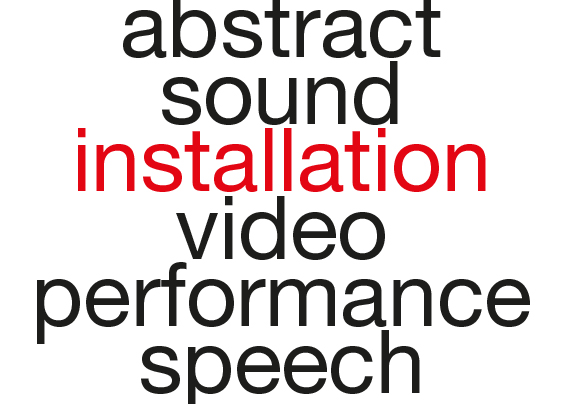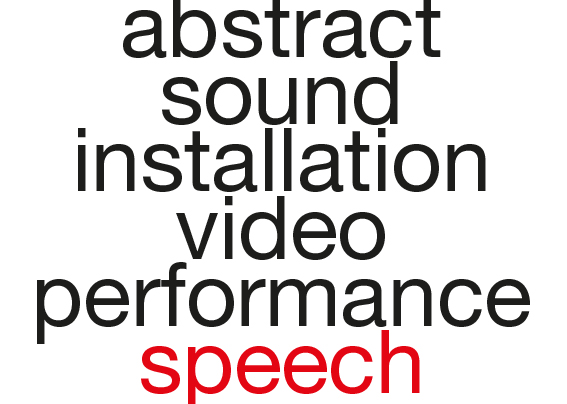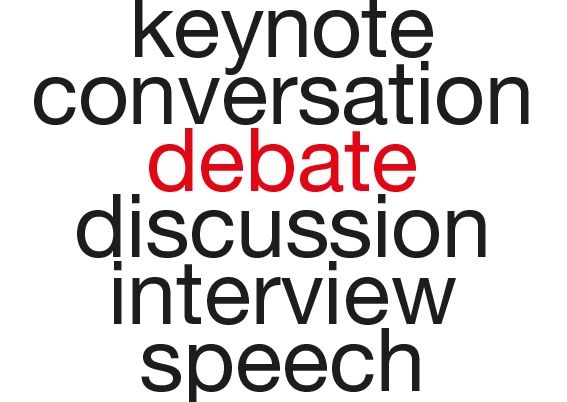Un_Universität / Un_University
HERAUSGEBER_INNEN: Ricarda Denzer und Jo Schmeiser
_
Stell einen Staubsauger an und lies die nächste Geschichte laut in den Lärm des Motors hinein. Vielleicht verstehst du dann dein eigenes Wort nicht mehr, aber du spürst deine Stimme im Hals und im Mund.*
_
Un_1
Im April 2016 veranstalteten wir unter dem Titel Un_University / Un_Universität eine Plattform an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Als Lehrende der Abteilung TransArts und als Künstlerinnen, die interdisziplinär und diskursiv arbeiten, sind wir gewohnt, klassische Grenzen zwischen den Disziplinen und Methoden infrage zu stellen. Dabei geht es nicht nur um künstlerisches Forschen oder um Gesellschaftskritik, sondern vor allem um das gemeinsame Denken und lustvolle Herstellen von neuen künstlerischen Ausdrucksformen und soziopolitischen Zusammenhängen.
In verschiedenen Sprech- und Aufführungsformaten – Keynotes, Podiumsdiskussionen, Demonstrationen, Vorträgen, Screenings und Workshops – setzten sich bei Un_University / Un_Universität Künstler_innen, Autor_innen, Lehrende und Studierende mit Formen der Lehre und des Lernens auseinander. Wir dokumentieren hier eine Auswahl ihrer Beiträge zur Plattform und ergänzen sie um Texte und Bilder von weiteren, eigens für dieses e-Journal geladenen Positionen: Jamika Ajalon, Fouad Asfour, Sabine Bitter & Helmut Weber, Eva Egermann, Simon Harder, Elke Krasny, Annette Krauss, Brandon LaBelle, Marlene Lahmer, Yen Noh, Roee Rosen, Jianan Qu, Rúbia Salgado, Studio Without Master, Nora Sternfeld, die «Universität der Ignorant_innen», Hong-Kai Wang.
Un_University / Un_Universität setzt sich mit Formen der Lehre und des Lernens in- und ausserhalb von (Kunst-)Universitäten auseinander. Wie prägen akademische Formate der Wissensvermittlung die Lehrinhalte? Wie können diese Formate aus der Perspektive künstlerischen Arbeitens neu betrachtet werden? Und welche Formate, welche Sicht- und Herangehensweisen werden anderswo, auch abseits akademischer Kontexte entwickelt? Der Unterstrich im Titel markiert eine kritische Denkbewegung von der Negation zur Affirmation und vice versa. Die Lehre an der (Kunst-)Universität wird mit künstlerischen Mitteln reflektiert. Wir diskutieren Formen des un_universitären Denkens, Sprechens, Hörens und Lesens und erfinden neue. Inner- und ausseruniversitäre Kontexte und Institutionen werden daraufhin befragt, welche gesellschaftskritischen Wissensproduktionen sie ermöglichen oder auch verunmöglichen.
Es findet ein kollektives Hören statt – auf der Ebene der Strukturen, der Lehrmodelle und der künstlerischen Methoden: Sprechen, Lesen, Körper und Raum, Sprache und Text werden zu Objekten und Medien (audio-)visuellen Engagements. Lehre und Lernen als kollektives Hören hängt mit einer Politik des Hinhörens zusammen, um die Frage stellen zu können: Was sind die Bedingungen eines solchen Hörens?
Das Ohr mischt sich in die Position des erkennenden Auges und der angreifenden Hand ein und es ist mit der Sprache verbunden. Wir schauen uns das Konzept des Hörens und der Stimme, wie bei Doris Kolesch und Sybille Krämer in Ach Stimme beschrieben, als performatives Phänomen an. Als sinnliche Wahrnehmungen im Raum. Als Bewegung zwischen dem Hier und Dort, dem Innen und Aussen, dem Sinnlichen und Sinnhaften. Die Stimme gibt einerseits die symbolische Bedeutung der Wörter wieder, sie verweist also auf etwas, während sich gleichzeitig etwas in der Stimme zeigt, das sich nicht sagen lässt, der Körper der Sprechenden zum Beispiel.
Das kollektive Hören basiert auf einer Politik der Örtlichkeit und Verortung, wie Encarnación Gutiérrez Rodríguez sie vorgeschlagen hat. Ausgehend von der Erkenntnis, dass «wir» in einer asymmetrischen und hierarchisch organisierten Gesellschaft oder Welt leben, kann das Wahrnehmen und Anerkennen anderer Orte und Kontexte der Wissensproduktion fruchtbare Debatten und Kooperationen hervorbringen. Aber es wirft auch die schwierige Frage auf, wer überhaupt daran teilnehmen kann und wer davon profitiert? Kritische Herangehensweisen müssen immer auch neue Formen und Strukturen entwickeln, die einer Vielfalt und Vielzahl von Menschen Zugang ermöglichen.
_
Setz in die Geschichte vom Kuchen deinen Namen anstelle von «Kuchen» oder sag «ich» dafür.*
_
Un_2
What we know without knowing / Anti-Lecture / (Unrehearsed)
Jamika Ajalon
RD: Unrehearsed könnte bedeuten, ohne Sicherheiten zu handeln.
JS: What we know without knowing hängt davon ab, wer diesen Satz sagt, aus welcher gesellschaftlichen Position.
Unhiding the body / Decolonial options / Undecided sound
Fouad Asfour
JS: Unhiding the body heisst, es sich zu erlauben, mit Gefühlen sichtbar zu werden, nicht nur mit dem Denken.
RD: Undecided Sound klingt nach der Möglichkeit, nicht von vornherein etwas auszuschliessen.
Die abgeschlossene Gestalt der Universität infrage stellen / Asynchrone Wissensräume / Ungleichzeitigkeit
Sabine Bitter & Helmut Weber
JS: Das Konzept der asynchronen Wissensräume stellt vergangene und gegenwärtige Geschichten nebeneinander, ihre mögliche Gleichberechtigung und die Debatten und Verhandlungen darüber, welche Geschichte wann, warum, von wem durchgesetzt wurde und wird, lassen sich an einer konkreten architektonischen Form zeigen.
RD: Asynchrone Wissensräume aufzuzeigen und zu schaffen ist ein wichtiger Aspekt künstlerischer Arbeit, der es ermöglicht, komplexe und neue Zusammenhänge zu thematisieren.
Normative Narrative verlassen / Krankheit als Waffe / Un/Sichtbarkeit
Eva Egermann
RD: Bei den Begriffen Un/Sichtbarkeit stellt sich die Frage nach der freiwilligen oder unfreiwilligen Un/Sichtbarkeit. Was wiederum voraussetzt, normative Narrative verlassen zu können.
JS: Normative Narrative kann ich nur verlassen, wenn ich begreife wie ich in sie eingebunden bin, und das kann ich meiner Erfahrung nach nur dann, wenn andere es mir zeigen, sagen, beibringen.
Stimmlosigkeit als Resultat gesellschaftlicher Gewalt / Raum für das bedrohlich Verdrängte schaffen / Probe
Simon Harder
RD: Das reizvolle an der Probe ist für mich die Vorstellung einer offenen Form, eines Ereignisses, das im Moment der Wahrnehmung eigentlich schon der Hauptakt ist.
JS: Die Probe als Form ermöglicht es, einem Experiment zuzuschauen und es gleichzeitig zu reflektieren.
Porosität / Gegenhandeln / Das Nicht-Gemeinsame im Gemeinsamen üben
Elke Krasny
RD: Porosität beschreibt eine sich durch (äussere) Einwirkung ändernde Materialität und die dadurch entstandene Möglichkeit einer Durchlässigkeit in zwei Richtungen: etwas wird eingelassen oder etwas tritt nach aussen.
JS: Institutionelle Porosität entsteht durch das Abgeben, Umverteilen und Ausserkraftsetzen von Privilegien, durch kollektive Enthierarchisierung und Neustrukturierung.
Entüben / Unlearning busyness / Unquestioned routines
Annette Krauss
JS: Die eigene busyness, Geschäftigkeit, überhaupt wahrzunehmen und nach ihrer Bedeutung zu fragen, ist schon sehr viel.
RD: Entüben klingt danach, dass die Dinge oder Handlungen immer auch anders sein könnten. Etwas nicht mehr zu können oder zu wissen, schafft möglicherweise neue Perspektiven.
Dissident imagination / Shelter for political homelessness / Collective making
Brandon LaBelle
RD: Dissident imagination und shelter for political homelessness drücken Formen eines politischen Handelns aus, die wir selbst durch die eigene Vorstellungskraft mitbestimmen und für die wir noch einen Ort schaffen müssen.
JS: Einen Raum für politisch Heimat- bzw. Obdachlose denken, entwerfen, gestalten – daran möchte ich mich beteiligen!
Unterrichtssprache / Working language / Übersetzung
Marlene Lahmer
JS: Unterrichtssprache/Working Language interpretiere ich so, dass es in jeder Unterrichtssituation um die Kritik an einer vorgesetzten Sprache gehen kann, mehr noch: um die Arbeit an einer gemeinsamen, egalitär bestimmten.
RD: Wessen Stimme höre ich in der Übersetzung?
Archival mind versus curatorial mind / Collective action / Non-privileged materials
Yen Noh
RD: Bei non-privileged materials muss ich an die Undefined Objects im Archiv des Technischen Museums in Wien denken. Diese UDOs sind Materialien und Gegenstände, deren (frühere) Funktion noch nicht zugeordnet werden konnte.
JS: Ein archival mind, ein archivarisches Hirn ist eine schöne Metapher zur kollektiven Aktivierung der ungenutzten Regionen in unseren Köpfen.
Inexistente Bücher / Fiktion als Methode / Opposition
Roee Rosen
JS: Fiktion als Methode erlaubt in der Praxis eine sehr lustvolle Form der Gesellschaftskritik.
RD: Fiktion als Methode und Opposition stellen für mich die Möglichkeit in den Raum, auch in politischen Ausnahmezuständen und Extremsituationen immer noch Handlungsmöglichkeiten zu schaffen.
A passive way of actively exchanging / I am related to this chair / Do you let the object look back?
Jianan Qu
JS: I am related to this chair ist eine geschickte Strategie zur Reflexion von Selbst und Gesellschaft.
RD: A passive way of actively exchanging setzt voraus, dass ein Nichthandeln schon ein Handeln ist.
Strände der hegemonialen Gesellschaft besetzen / Ausseruniversitäre Erwachsenenbildung / Enttechnokratisierung der Universität
Rúbia Salgado
RD: Den Strand besetzen und Treibgut finden ist mein Bild dazu. Oder könnte man durch das Anerkennen von Zufall die Technokratisierung der Universität unterlaufen?
JS: Die Enttechnokratisierung der Universität könnte diese im Handumdrehen in einen belebten und beliebten gegenhegemonialen Strand verwandeln.
Sounding ventriloquism / Head and belly / Not in and not out, but entangled with school
Studio Without Master
RD: Beim Sprechen die Hierarchie zwischen head and belly aufzulösen und als Metapher und Vorschlag zu lesen, institutionelle Hierarchien anders zu denken, dazu stelle ich mir folgende Szene vor: Head and belly einer kopflosen Figur, die ihren Kopf unter den Arm neben dem Bauch geklemmt hat, führen einen regen Dialog in einer Sprache, die nach brummenden, schmatzenden, grummelden, schnalzenden oder glucksenden Geräuschen klingt.
JS: Sounding ventriloquism lässt verinnerlichte Autoritäten kakophonisch erklingen – Regeln, Gesetze, Traditionen werden im Hin und Her von Kopf und Bauch erst bewusst, dann deplatziert und dadurch neue Handlungsspielräume von unten eröffnet.
Post-repräsentatives Vermitteln / Verhandeln mit der Realität / Para-institutionelle Praxen
Nora Sternfeld
JS: Mit der Realität verhandeln gefällt mir, weil es beobachtet, was ist, und zugleich einen Möglichkeitsraum gestaltet.
RD: Mit der Realität zu verhandeln ist auch ein Bestandteil meiner künstlerischer Arbeit.
Wissen kauen und wiederkauen / Niemand ist «tabula rasa» / Ignorieren ist machtvoll
Die «Universität der Ignorantinnen»
JS: Niemand ist «tabula rasa» verweist auf Geschichte/n, die uns zu Profiteur_innen und Vertreter_innen von Herrschaftsverhältnissen machen, aber auch auf zukünftige Möglichkeiten einer grenzenüberschreibenden Praxis an der Universität – auf eine strukturelle Haltung der Wechselseitigkeit: Wer lernt, wer lehrt und wer wertet was von wem wie und warum?
RD: Wissen kauen und wiederkauen provoziert die Vorstellung, dass die Verdauung schon im Mund beginnt, das Wissen sozusagen nicht einfach nur geschluckt wird.
Listening as a mode of organizing sociality / What emerges in the silence of … / Performative Hörsitzung
Hong-Kai Wang
JS: Smashed to Pieces in the Still of the Night / Zerschmettert in Stücke in der Stille der Nacht: Diese Lyrics von Lawrence Weiner und der Schriftzug auf einem Flakturm der Nazis in Wien fällt mir zur Frage ein, was in der Stille von … entsteht, die Auseinandersetzung mit den Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart.
RD: Sound hat eine deterritoriale Kraft, Listening as a mode of organizing sociality drückt für mich daher auch die politische Dimension des Hörens aus.
_
Die folgende Geschichte ist besonders schön, wenn du beinahe nichts davon verstehst. Zum Beispiel, wenn jemand, der oder die im Nebenzimmer sitzt, sie dir halblaut vorliest. Du hörst nur den Klang der Stimme, das Räuspern und Husten und errätst vielleicht ein Wort dann und wann, «essen», und später vielleicht noch «Haus» oder «Antwort». Wenn die Person im Nebenzimmer über die Geschichte lacht, kannst du ruhig mitlachen: Die Geschichte ist lustig.*
Download Editorial in english: AER13_editorial_20170330_engl
_
Anmerkung:
* Wir bedanken uns bei Fouad Asfour für den wunderbaren Hinweis auf das Buch: Dieser Hund heißt Himmel von Jürg Schubiger. Zitate auf Seite 42, 13 und 25.
_
_
Herausgeber_innen #13: Un_University
Ricarda Denzer, Jo Schmeiser
Herausgeberin Art Education Research
Carmen Mörsch
Redaktion
Jo Schmeiser, Bernadette Schönangerer
Übersetzung
Nicholas Grindell
Anna Kowalska: annakkow@yahoo.com
Layout Texte
Anne Gruber
Die Herausgeber_innen danken Nora Landkammer, Richard Ferkl, Ulrike Holper, Barbara Putz-Plecko, Gerald Bast sowie allen Autor_innen, Mitwirkenden und vor allem den universitären Einrichtungen, die diese Publikation finanziert haben:
Institute for Art Education, ZHdK
Rektorat der Universität für angewandte Kunst Wien
Abteilung TransArts, Universität für angewandte Kunst Wien
Abteilung Kunst und kommunikative Praxis, Universität für angewandte Kunst Wien
_