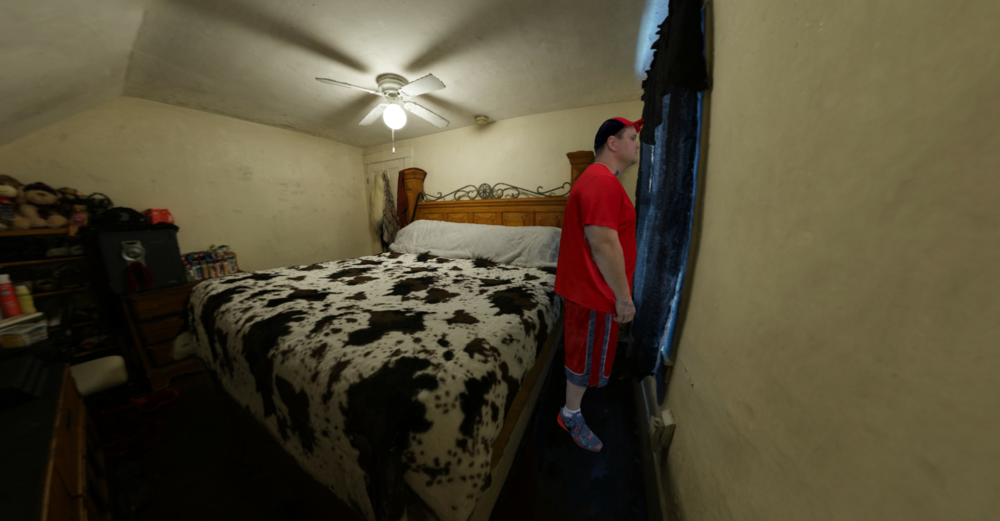Simon Guy Fässler studierte nach einer Chemielaborantenlehre und der Berufsmaturität Visuelle Kommunikation im Fachbereich Film/Video an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg. Er arbeitet seither als freier Kameramann, Autor, Filmemacher und Produzent mit Basis in Zürich. Simon Guy Fässler ist Gründungsmitglied der Produktions- und Stoffentwicklungsfirma 8horses. Für seine Kameraarbeit im Spielfilm Aloys (Regie Tobias Nölle) wurde er 2012 mit dem Schweizer Filmpreis für „Beste Kamera“ ausgezeichnet und an der Camerimage für den Preis in der „Cinematographer’s Debut Competition“ nominiert.
> Beitrag bei ZDOK.19: Rollenwechsel der Kamera: Vom Eindringling zum Erzählwerkzeug
- 2019 Ruäch (Regie: Andreas Müller & Simon Guy Fässler) in Produktion
- 2018 Chris The Swiss (Regie: Anja Kofmel)
- 2017 Passion (Regie: Christian Labhart) in Produktion
- 2015 Looking Like My Mother (Regie: Dominique Margot)
- 2019 Ruäch (Autor und Co-Regisseur) in Produktion
- 2011 Onkel Albin