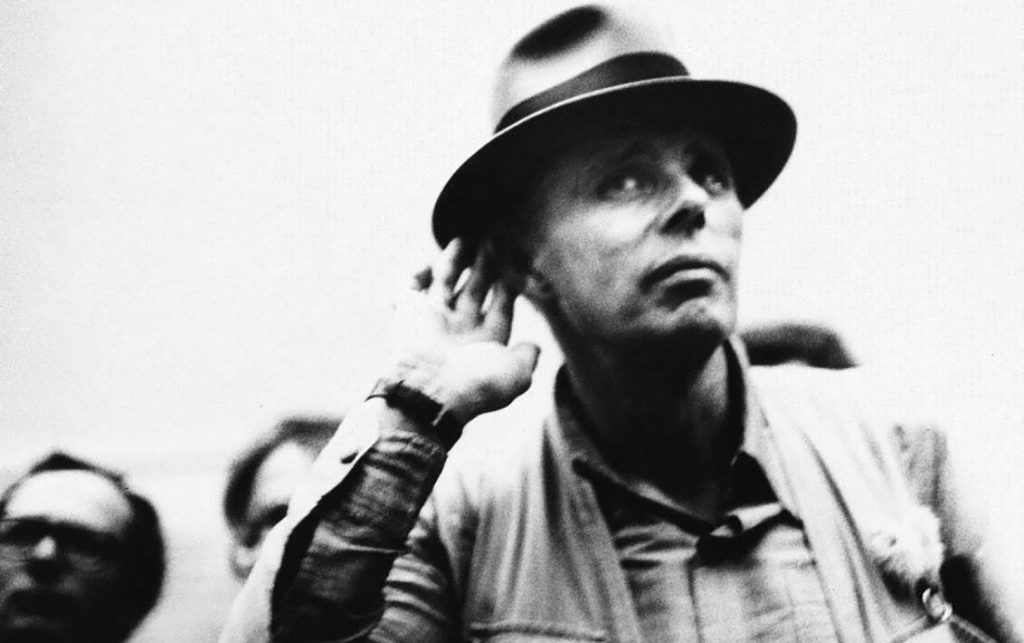von Magali Trautmann
Dokumentarfilme erzählen Geschichten. Aber wie? Was braucht es für eine gute Geschichte? Wie wird Material der vorfilmischen Wirklichkeit zu einer Erzählung montiert? Und welche alternativen Strategien gibt es?
In meinem Vortrag stelle ich ein Modell vor, dass zwei Wege der Vermittlung vorsieht: einen themen- und einen handlungsgeleiteten. Der themengeleitete (argumentative) Dokumentarfilm bebildert ein Anliegen mit Fremdaufnahmen, ergänzt diese um Experteninterviews und beliebige Grafiken, Modelle oder Archivaufnahmen und kommentiert sie anonym (exogene Montage). Der handlungsgeleitete (narrative) Dokumentarfilm hingegen konstruiert aus Eigenaufnahmen heraus eine Erzählung mit einem Spannungsbogen, einer Handlung und Handelnden (endogene Montage). Die argumentative Form findet man vor allem in TV-Dokumentationen vor, die über historische, naturwissenschaftliche oder evolutionäre Themen berichten. Der Erstaufführungsort des narrativen Dokumentarfilms ist das Kino. Seine Erzählungen sind Heldengeschichten mit einer durchdachten Dramaturgie, Bild- und Tonkomposition, die dem fiktionalen Film in nichts nachstehen.
Wie nah der narrative Dokumentarfilm dem Spielfilm tatsächlich kommt, ohne dabei mit Nachstellungen, Kulissen oder Schauspielern zu arbeiten, welche Tricks und Techniken er anwendet, um die Zuschauenden zu erreichen und vor allem, wie dessen Montage im Detail aussieht, lege ich in meinem Vortrag dar. Anhand aktueller Beispiele, darunter der Film WEIT. Die Geschichte von einem Weg um die Welt (Patrick Allgaier/Gwendolin Weisser D 2017), der seine handlungsgeleitete Absicht bereits im Titel trägt, werde ich aufzeigen, wie eine fiktionalisierende Montage aussehen kann.