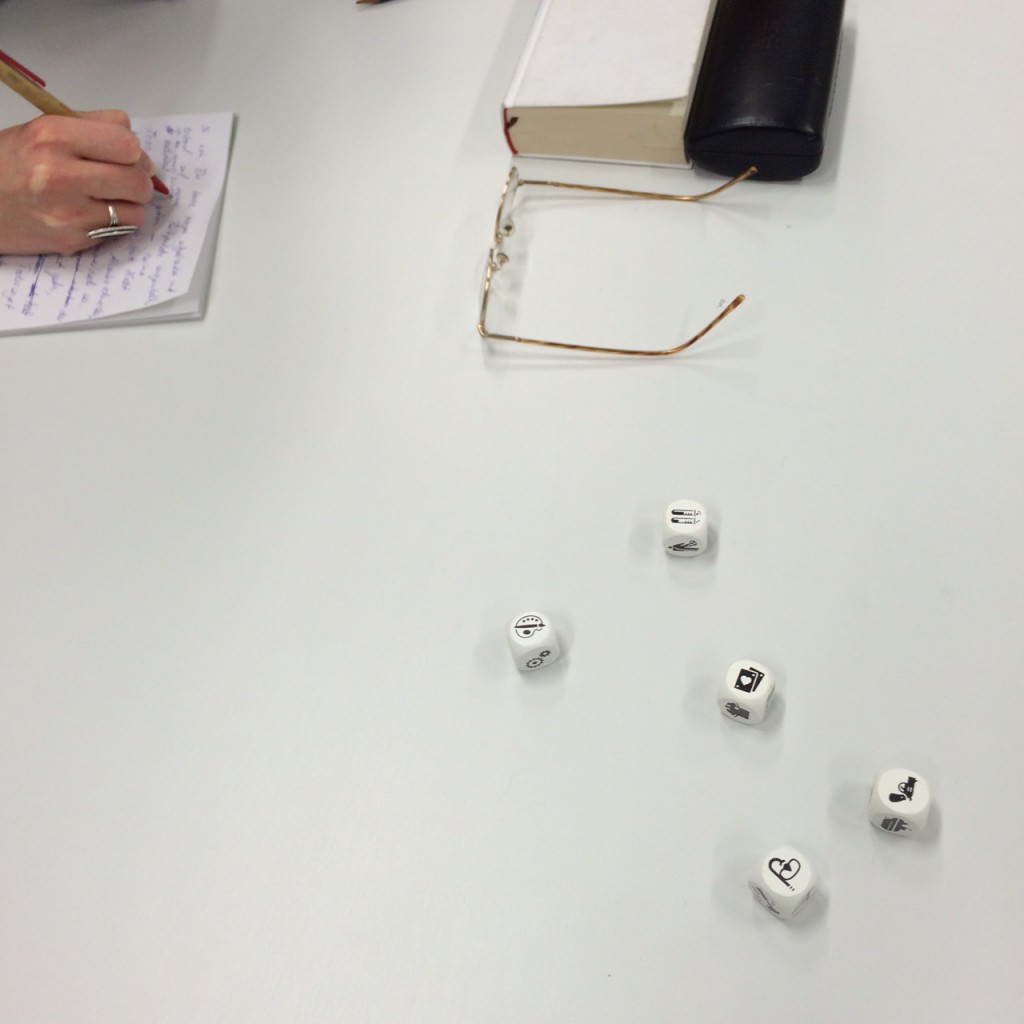Text: Gerhard Meister
Also wer ist dafür?
Doch ich denke, wir können das machen, Studiobühne natürlich.
Ich bin doch für den Wedekind.
Also ich meine, dieses Lebensgefühl, diese Probleme, das kommt doch eigentlich ganz schön zum Ausdruck. Er hat doch eigene Bilder.
Wir sind jetzt aber nicht in irgendeinem Wedekindjahr oder hab ich da was verpasst?
Natürlich kennt man das alles. Natürlich sind das nicht unserer Probleme.
Wir haben noch nichts in diesem Segment.
Ist aber nicht wirklich was für Schulklassen.
Deshalb bin ich ja für Wedekind.
Im Theater muss es ja nicht immer um die eigenen Probleme gehen.
Im Gegenteil.
Ich denke auch, dass es doch recht hübsch in die Lücke passt, die wir in unserem Spielplan noch haben.
Also wir hätten da einen Regieassistenten, der könnte das machen, vier Wochen Probezeit.
Quick and Dirty.
Wie immer in solchen Fällen.
Also, das kann man doch so nicht sagen.
Vom Autor hat man bisher nichts gehört?
Nein, wir hätten den dann entdeckt.
Na immerhin das.
Stimmen wir doch ab.
Gut, stimmen wir ab.