Aus der Geschichte der Studentenrevolte: Mehr Theorie, gegen Design!

(Türe zum Atelier der Diplomklasse Industrial Design an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich, fotografiert im Herbst 2007)
Grundlagen einer Designtheorie
Seminar Industrial Design FS 2017
Aus der Geschichte der Studentenrevolte: Mehr Theorie, gegen Design!

(Türe zum Atelier der Diplomklasse Industrial Design an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich, fotografiert im Herbst 2007)
Christian Demand spricht in seiner Designkolumne wohl so manchem Studenten, so mancher Studentin aus dem Herzen, zumindest im Titel: „Theoriemüdigkeit“. Leichte Lektüre ist das allerdings nicht. Immerhin erscheint die Kolumne in der Zeitschrift Merkur, einer anspruchsvollen Kulturzeitschrift für ein geschultes Publikum, das heisst für ein Publikum, das über ein bestimmtes Referenzsystem verfügt und beim Lesen gewillt ist den Kopf hellwach zu schalten. Lesenswert ist der Text aber allemal.
Demand formuliert mit spitzer Zunge, etwa wenn er den theoretischen Gehalt von Designzeitschriften beschreibt:
(…) Die nicht weniger zahlreichen Designperiodika wiederum veredeln optisch zwar verlässlich die Zeitschriftendisplays gutsortierter Buchhandlungen, ihre intellektuelle Flughöhe aber ist bei aller Ambition zumeist umgekehrt proportional zum gestalterischen Aufwand. (…)
Er beobachtet, dass im deutschsprachigen Raum eine kluge Designtheorie seit den 1970er Jahren (!!!) so gut wie nicht mehr existiert. Der einzige in diesem Feld ernst zu nehmende Denker sei Gert Selle. Die grosse Qualität von Selle liegt, so Demand, darin, Fragen zu stellen, die er nicht zu beantworten vermag und sich beobachtend, ja staunend der gestalteten Welt zu nähern. Das sei „Theorie im besten Sinne: ein (…) informiertes wie geduldig hinsehendes Nachdenken.“
Der Lektüretipp gilt daher Gert Selle. Seine „Geschichte des Designs in Deutschland“ bietet allerfeinste Sommerlektüre.
Manchmal zweifle ich, ob es richtig ist, in meinen Seminaren immer und immer wieder nach dem Designbegriff zu fragen. Wenn ich dann beim Prokrastinieren (= Herauszögern von unangenehmer Arbeit) über einen Veranstaltungshinweis mit dem Titel „Vortragsreihe: Was ist Design? Revision eines Begriffs“ stolpere, wirkt das doch entlastend. Denn wenn ausgewiesene Expertinnen und Experten auf Einladung einer deutschen Hochschule reihum versuchen dem Begriff auf die Spur zu kommen, kann es nicht komplett falsch sein, hin und wieder auch in einem Seminar zu fragen: Was? Design?
Im dritten Semester wird es immer wieder mal um Semiotik und Semantik gehen, also um die Kunst Zeichen und Bedeutungen zu setzen – mit den Mitteln des Designs. Einen schönen Vorgeschmack darauf gibt dieser Text über so genannt selbstreferentielles Design. Auf der Strasse, im Einkaufszentrum, Zuhause und unterwegs beobachtet der Autor Dinge, die sich gestalterisch auf sich selbst beziehen: Eieruhren in Eierform zum Beispiel. Dabei beobachtet er genau, skizziert das Beobachtete mit der Handykamera und deutet es in kurzen, pointierten Sätzen.
Der leicht lesbare Text und die zahlreichen Bilder aus dem Notizbuch des Autors ist nicht nur wegen dem designtheoretischen Ansatz interessant, sondern auch weil er zeigt, wie wir vom Alltag lernen können, wie wir von „schlechtem“ Design lernen können, wie wir über die gestaltete Umwelt nachdenken können.

Foto: Franziska Nyffenegger
Bildlegende: Ein Spielplatzgerät in Form eines Tête-de-Moine-Schneidegeräts vor dem Tête-de-Moine-Museum in Bellelay – kein selbstreferentielles Design, aber fast.
Wie verändert sich das Verständnis von Design im Laufe des ersten Studienjahres?
Vor dem Studium, so der Tenor in der Klasse, war da entweder gar nichts oder dann eine naive Auffassung: Design als etwas Grosses, etwas Spezielles, etwas Gutes; Design als Königsdisziplin, der es gelingt, die Welt schön zu machen, ein wenig schöner, zumindest. Das Studium öffnet den Blick. Vorlesungen, Seminare, Fragestunden und mehr zeigen, dass es gar nicht so einfach ist eine Haltung einzunehmen, dass Design vielfältig ist, und auch, dass Designer keine Zaubernden sind, sondern wie alle Handwerker (auch nur) mit Wasser kochen.
Im zweiten Semester ist klar: Es gibt keine allgemein gültige Definition; dafür gibt es viele verschiedene, sich teilweise widersprechende und häufig subjektiv gefärbte Auffassungen davon, was Design ist und was Design sein soll. Der Begriff differenziert sich aus; er schillert in vielen Farben, meint alles und nichts. Klar ist auch, wie viel im Design möglich ist und wie vielfältig die Wege im Design sein können. Und dass der Begriff nicht geschützt ist. Es gibt kein Design®.
Weniger klar als noch vor dem Studium, sind die Kategorien „gut“ und „schlecht“, „richtig“ und „falsch“, „schön“ und „hässlich“. Die Sache ist komplex. Was die Zukunft bringt und ob Design dafür Lösungen liefern kann, bleibt offen.
Simone Bonanni, 27 Jahre alt, Produktdesigner in Mailand mit eigenem Studio im Gespräch mit dem Zeit-Magazin:
Ich versuche, mir meinen Tag in Sand und Steine einzuteilen. Meine Arbeit im Studio ist wie eine Vase: Wenn ich die Vase zuerst mit Sand fülle, also mit irrelevanten Dingen wie Facebook, E-Mails und Chats mit Freunden, ist am Ende kein Platz mehr für die Steine. Also fange ich mit den Steinen an, und wenn ich hinterher noch etwas Sand daraufkippe, füllt der den Platz zwischen den Steinen aus. Die Steine, das sind für mich die wichtigen Dinge und großen Projekte, mit denen ich gleich am Morgen beginne, wenn mein Kopf noch frisch und ausgeruht ist. Im Lauf des Tages kommt dann der Sand dazu. Am Abend lese ich. Ich finde es wichtig, mich weiterzubilden und mir neues Wissen anzueignen. Manche Designer vergessen das. Wenn sie älter werden, produzieren sie nur noch Abwandlungen ihrer alten Ideen. Oft bin ich abends sehr müde. Ich brauche den Schlaf, um meine Gedanken und meine Ideen zu ordnen. Manchmal wache ich tatsächlich mit der Lösung eines Problems auf.
Quelle: Zeit Magazin, Nr. 15, 2017, online veröffentlicht am 11. April 2017.
Wenn das Projekt einen Namen bekommt – und sei es auch nur einen vorläufigen, superprovisorischen, der ganz bestimmt nie der richtige Name sein wird –, lässt sich einfacher darüber nachdenken. Arbeitstitel helfen, um sichtbar zu machen, was der Gedankenstand ist, in welche Richtung es gehen kann (oder könnte), wo das Interesse liegt.
Darum hier als Kommentar: mindestens ein Arbeitstitel (besser noch: drei möglichst unterschiedliche) zum Essay-Projekt.
Seit über zwei Jahren arbeiten wir daran; mit eurer Unterstützung wird sie diesen Herbst erstmals stattfinden: die DesignBiennale Zürich. Jetzt den 4-Tagespass kaufen und exklusiv profitieren! – Die ideale Ostergeschenkidee für Eltern und Grosseltern, Tanten und Onkel!
Und sowieso: das Datum vormerken – 7. bis 10. September 2017.
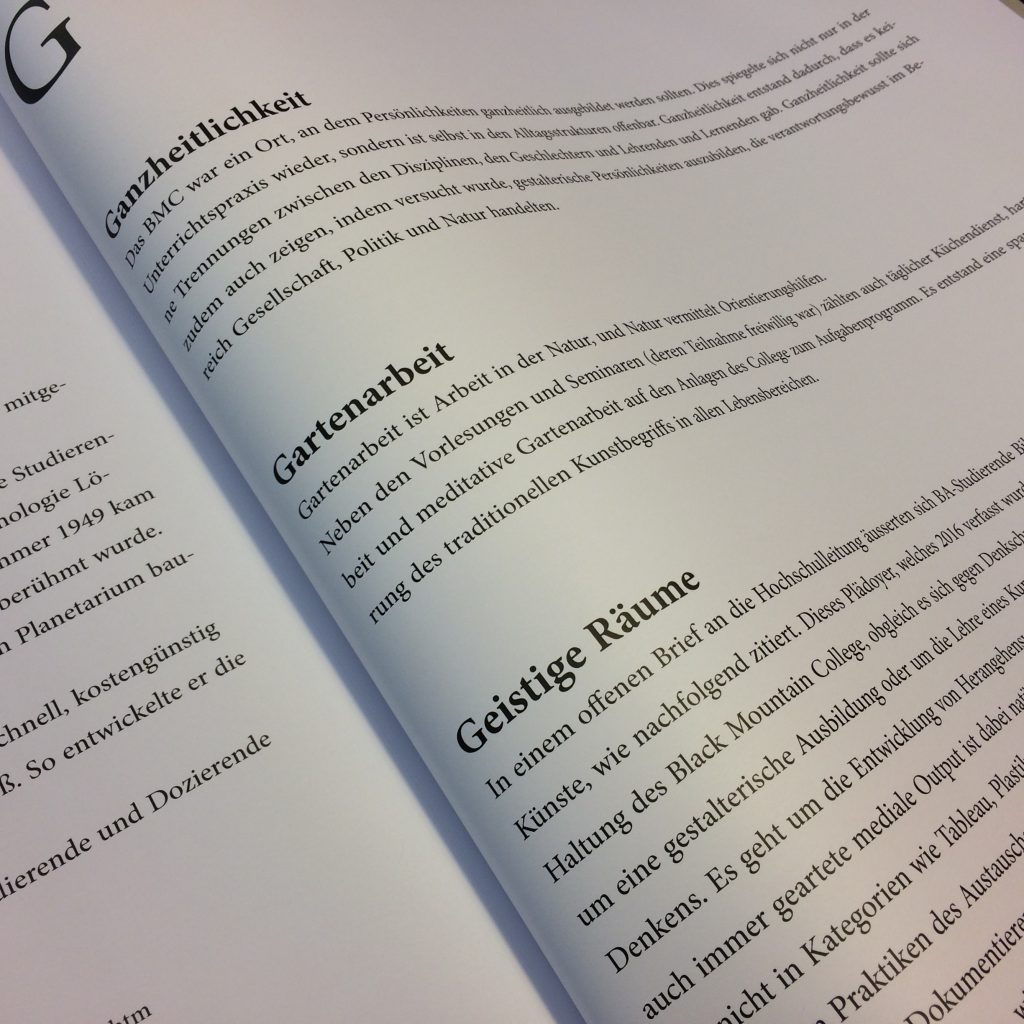
(gesehen am Designsymposium 2017, The Black Mountain College Glossar)
Wäre der Zugang zu Designgeschichte und Designtheorie einfacher, wenn das Fachtheorieseminar im Garten der Dozentin stattfinden würde? Kompost statt Kulturkritik? Würmer statt Worte?